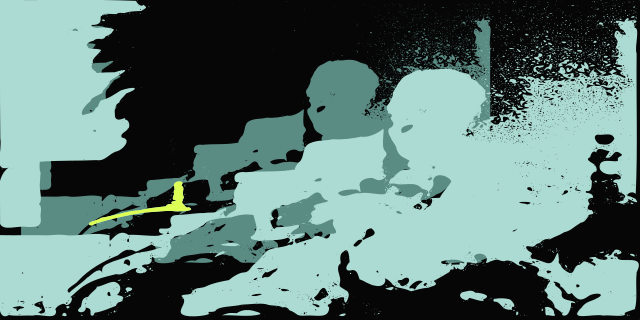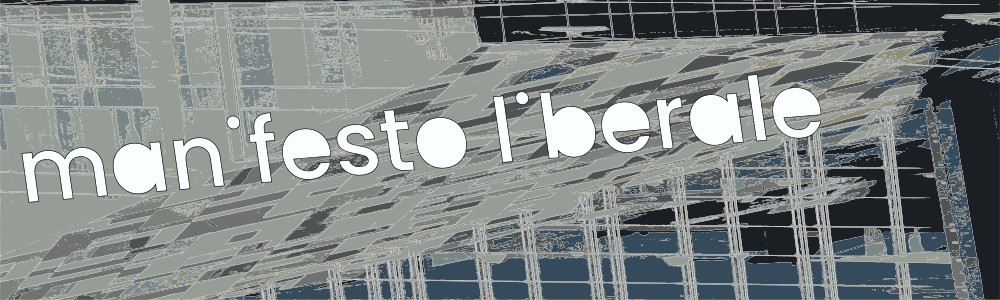von Ulrich Siebgeber
Nun, es sollte einmal gesagt werden, beiläufig meinethalben, aus Anlass einer beliebigen Preisverleihung: Jürgen Wölbing ist ein bedeutender Künstler, ein Zeichner und Grafiker, aus dessen Fingerspiel die feinsten Ungeheuerlichkeiten hervorgegangen sind, einer von denen, die den durchsichtigen Stab gefunden haben, mit dem man die Lamellen der Wirklichkeit auseinanderdreht, weniger, um hindurchzusehen, als sich an dieses Spiel zu verlieren.
Man sieht aber wirklich hindurch, nicht in ein ausgepinseltes Drüben, keine Vision, bewahre: man sieht das Fadenscheinige, die losen Enden. Eine perspektivlose Sonne spielt mit ihnen, lässt sie erglimmen oder stumpf ins Abseits stechen und entgleiten. Man sieht diese Enden so, wie man durch die Finger sieht – eine Kinderübung, die unter Erwachsenen zur groben Phrase verkümmert. Hier gibt es keine forcierten Kinder-Blicke, alles ist erwachsen. Kein heiliger Klee wächst in diesen Blättern. Nur der nicht minder heilige Benjamin geistert durch sie hindurch. Dieser Zeichner ist, wie viele andere, von jenem Jahrzehnt gezeichnet, das jetzt bald ein halbes Jahrhundert zurückliegt und allenorts Leichen produziert, wirkliche und metaphorische. Das Leichengift der sechziger Jahre, das mehr Wirkstoffe enthält als ein aufgeblasener ’68er Mythos zulassen möchte, steckt in Wölbings Blättern, es ist ihr Opium, ihr Absinth, ihr LSD. In feiner Dosierung entströmt es ihnen, man kann jahrzehntelang damit leben. Dann spürt man seine Wirkungen wie ein alter Bauer das Gliederreißen oder das Rheuma, das für so vieles steht.
Vielleicht hat sich der Zeichner irgendwann ins Gebirge verirrt. Wir wissen es nicht, vermutlich geben die Aufzeichnungen darüber nichts her. Die chinesische Tuschezeichnung ist ein mächtiger Zeiger, gleich daneben, in einem wohltuenden Abseits, die Romantik. Man geht durch Türen und ›ist der Welt verloren‹, wie es bei den Klassikern heißt. Man poltert auch nicht geraden Ganges hinein. Man biegt, neugierig tastend, ein wenig ab, betastet diesen, betastet jenen Gegenstand und ist gebannt – von einem Gemälde vielleicht in einem Bildband, der einem von einer Ausstellung zugeschickt wurde. Es rührt die nur in dicken Geldbündeln aufzuwiegende Weltfremdheit und man weiß nicht mehr so recht, was dieses Wort bedeutet... So etwa könnte es gehen. Vielleicht auch anders. Man nennt das, ohne viel Überzeugung, Kairos. Wölbing konnte ein Leben lang pfiffig verschweigen, worum es ihm geht. Er hat niemandem das Recht verwehrt, so zu reden, er hat selbst diese Anläufe produziert, es so zu sagen, aber es ging nicht. Es ging und geht nicht. Die Hand ist schneller, sie ist langsamer. Sie ist genauer. Man kann ihr die Bebilderung eines Buches anvertrauen wie eine feine Lötarbeit und darf sicher sein, dass ›es geht‹. Warum auch immer. An diesen Aufbrüchen, aus was auch immer, von was auch immer, ins ganz oder halb Abgewandte, erkennt man seine Sachen. Was in seine Bilder gerät, hebt sich hinweg. Nicht unfriedfertig, nicht maulend, keineswegs glänzenden Gesichts oder erwartungsvoll, aber: es hebt sich hinweg und bedarf dazu keines Wortes. Vor Wölbings Bildern erlernt niemand das Schweigen, man kann es.
Das sagt sich dahin, aber so ist es nicht. Wölbing hat seine Blätter immer fortgegeben, wie sie entstanden – eine romantische Geste, die sich als gesellschaftskritisch missverstand. Noch existiert kein Werkverzeichnis, noch haben die Museen ihre Scheinwerfer nicht auf dieses Œuvre gerichtet, die Verlage schichten ihre wunderbar bebilderten Bücher vermutlich von einer Lagerecke in die andere, Sammler schütteln milde den Kopf über die sich nicht entwickelnde Anlage, das wird sich ändern. Der Zeichner ist seit Jahren verstummt. Der Schweigende ist verstummt. Was alle aufs höchste irritiert, die ihn kannten und kennen, hat die öffentliche Seite mit der ihr eigenen Gleichgültigkeit quittiert. Wo so viele auf der Strecke bleiben, dreht man sich besser nicht um. Das ist schade, dadurch entgeht einem manches, ein Blick zum Beispiel, der einen zeichnen könnte. Wer will das schon. All diese im Fortgehen begriffenen Landschaften aus Heterogenem senden diesen Blick aus. Nein, du bleibst, wo du bist, sagt dieser Blick, du bleibst hier. Ich bin weiter. Von mir aus betrachtet ist deine Existenz fadenscheinig, aber das kann nicht dein Blick sein, sonst wären wir weiter. Das ist nicht der Fall. Was immer der Fall sein mag, aber das ist nicht der Fall. Wir kommen nicht weiter. Das mag eine gesellschaftliche Wahrheit sein. Wenn dem so ist, lass sie uns verschweigen. Lass sie uns einfach... verschweigen. Ich bin nicht deine Wahrheit, da sei der heilige Marx vor, der heilige Benjamin oder der heilige Bob Dylan. Natürlich habe ich sie kennen gelernt, diese Heiligen, im Rausch, in der Ekstase am Zeichenbrett. Es ist lange her und ich habe sie intus. Übrigens eine merkwürdige Verfassung, in der nichts mehr wächst außer dem Abstand, den man den lichten nennt, aus einem Grund, den man an mir besichtigen kann. Man gewinnt auch von Heiligen Abstand, aber man verrät sie nicht. Meinen Verrat, wenn es ihn gibt, sieht man nicht. Ich bin nur ein Blick.
Pauvre Wölbing – er hat zu wenig oder zu viel Moderne im Leib, das ist sein Fehler. Es ist kein wirklicher Fehler, sondern ein Los, das er mit vielen teilt, darunter solchen, die sich lauthals beschweren. Was er nicht tut, niemals getan hat. Überhaupt ist es das Wirksame an diesen Bildern, dass sie sich nirgends beschweren. Sie stemmen keine Gewichte, sie gleiten vorbei. Sie sind keine Passierscheine in eine bessere oder katastrophische Zukunft. Eine Generation pharisäerhafter ›Das haben wir gemacht‹- und ›Das werden wir angehen‹-Typen hat sich an ihrem abwesenden Ausdruck geweidet, als handle es sich um den unvermeidlichen Kater vor und nach der Tat, oder sich achselzuckend und ratlos abgewendet. Das war schade, aber an keiner Stelle zu ändern. Was die Nachrücker angeht, so haben sie sich noch nicht entschieden, ob sie der Kinoversion jener Jahre glauben oder ihrem Misstrauen folgen sollen.