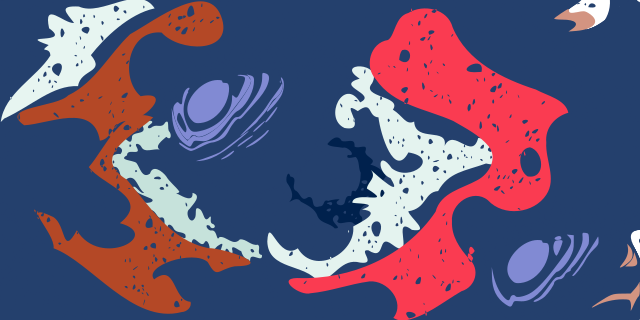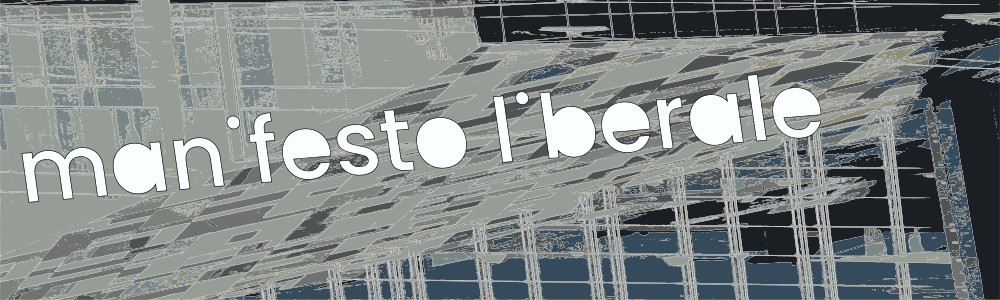von Christoph Jünke
Wer sich um die Ursprünge des welthistorischen Dramas des 20. Jahrhunderts kümmert und im deutschen Nazi-Faschismus mehr zu erkennen sucht als die welthistorische Einzigartigkeit, die dieser auch gewesen ist, wird zurückgehen müssen auf die vorletzte Jahrhundertwende und den Blick wenden auf das deutsche Kaiserreich. In den fast fünf Jahrzehnten des so genannten Wilhelminismus reiften jene Verhältnisse, die sich in den Ersten Weltkrieg und die daran sich anschließende Epoche von Revolution und Konterrevolution eruptiv entluden.
Annelies Laschitza: Die Liebknechts. Karl und Sophie – Politik und Familie, Berlin (Aufbau-Verlag) 2007, 511 S.
Es waren die Schicksalsjahre Deutschlands, als sich nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 das liberale Bürgertum mit der ökonomischen Macht begnügte und sich politisch mit dem autoritären Militär»feudalismus« arrangierte. Die unter Preußens Vorherrschaft erfolgte so genannte kleindeutsche Einigung und der industrielle Take-Off des weltökonomischen Nachzüglers, die autoritäre Neuformierung nach innen und ihr Griff nach der Weltmacht produzierten eine Gesellschaft, die unter der Oberfläche von Ruhe, Stabilität und Expansion ein Gemengelage von Widersprüchen zur Entfaltung brachte, die ihresgleichen sucht – und sich nicht zuletzt in der sich damals stürmisch entwickelnden deutschen Arbeiterbewegung niederschlug. Von der blutigen Niederschlagung der Pariser Kommune, der ersten proletarischen Machtergreifung 1871, über die Bismarckschen Sozialistengesetze und die machtvolle Neuformierung einer sozialdemokratischen Zweiten Internationale mit ihren Massenparteien und Gewerkschaftsbewegungen bis zum klassenpolitischen Burgfrieden im Ersten Weltkrieg; von den weitreichenden Hoffnungen auf ein unmittelbar bevorstehendes sozialistisches Paradies über die Verlockungen einer gesellschaftspolitischen Anerkennung und Integration bis zur dauerhaften Spaltung in mehrere Strömungen – es waren auch die Schicksalsjahre der deutschen wie internationalen Arbeiterbewegung klassischen Zuschnitts. Und es gibt nur wenige Leben, in denen sich diese schicksalsschweren fünf Jahrzehnte so herausgehoben und sinnfällig spiegeln wie in dem von Karl Liebknecht.
Der im August 1871, nur wenige Monate nach der Zerschlagung der Pariser Kommune Geborene war mehrfach Kind seiner Zeit und ihrer Arbeiterbewegung. Als Sohn Wilhelm Liebknechts, des neben August Bebel bekanntesten Mitbegründers und herausragenden Führers der deutschen Sozialdemokratie, gleichsam organisch hineingewachsen in das Milieu der radikalen Arbeiterbewegung, verkörperte der junge Karl auch deren Kultur. Der schulisch überdurchschnittlich Begabte eignete sich die klassische bürgerlich-humanistische Bildung an und entwickelte eine hierfür typische Liebe zur Kunst und Musik wie zur Natur. Wie selbstverständlich sah auch Liebknecht dieses Erbe unter den Bedingungen der polarisierten Klassengesellschaft im politisch wie ökonomisch aufsteigenden Proletariat verkörpert. Aufgewachsen unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes promovierte er 1897 in den Fächern Rechtswissenschaft und Nationalökonomie, ohne dass ihm die bürgerliche Gesellschaft eine Möglichkeit zur Integration anzubieten gedachte. Der solcherart Ausgegrenzte musste sich beruflich durchkämpfen und machte sich zu Beginn des neuen, des 20.Jahrhunderts zum »Anwalt der kleinen Leute«, verteidigte vor allem die sozial Schwachen und politisch Verfolgten. Er offenbarte eine spezifische Mischung aus Impulsivität und Beharrlichkeit, in der sich nur unschwer die tief greifenden Widersprüche seiner Zeit und seines Milieus spiegeln, jene für den damaligen marxistischen Sozialismus so typische Mischung aus naturgesetzlichem Glauben und politisch-ethischem Voluntarismus.
Lange Zeit am Rande des eigentlichen politischen Geschehens sich bewegend, wurde Karl Liebknecht erst nach dem im Jahre 1900 erfolgten Tod seines allmächtigen Vaters auch direkt politisch aktiv. Bereits ein Jahr später wurde er ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt, 1908 ins Preußische Abgeordnetenhaus und 1912 schließlich in den Deutschen Reichstag. Bis dahin hatte er sich einen eigenen Namen gemacht als Aktivist und Repräsentant der aufkommenden internationalen Jugendbewegung sowie als radikaler Antimilitarist, der enge Kontakte pflegte vor allem zur russischen revolutionären Emigration. Der jugendbewegte Antimilitarismus und intensiv gelebte Internationalismus ließen ihn zwar zur einflussreichen Person werden, doch wirklich bekannt wurde Liebknecht erst, als er seine Parlamentsarbeit dazu benutzte, die Machenschaften der deutschen Rüstungsindustrie – dessen, was später der militärisch-industrielle Komplex genannt werden sollte – offen zu legen und anzugreifen. Dass er dafür als vermeintlicher Hochverräter hinter deutsche Gitter musste, war dem exponierten Kämpfer gegen die bürgerliche Klassenjustiz weniger ein Problem als die Tatsache, dass auch seine sozialdemokratischen Genossen zunehmend auf Distanz gingen. Doch so sehr er die SPD zum offensiven Kampf gegen den heraufziehenden Krieg drängte, so überrascht war er selbst, als dieser dann plötzlich auch ausbrach.
Es brauchte lange, sehr lange, bis Liebknecht sich aus der babylonischen Gefangenschaft der sozialdemokratischen Partei- und Fraktionsdisziplin zu lösen vermochte. Im Dezember 1914 verweigerte er als einziger Abgeordneter die Zustimmung zu den Kriegskrediten und wurde schlagartig zum politischen Symbol. Zu einem Symbol, auf das die europäische Welt schaute – im Guten wie im Bösen. Erst jetzt nahm seine Politik wirkliche Konturen an, denn er arbeitete nun zunehmend mit der Partei-Linken um Rosa Luxemburg und Franz Mehring zusammen, die ihn bis dahin eher als eigensinnigen Einzelgänger betrachtet hatten. Liebknechts Unversöhnlichkeit und sein Hang zur symbolischen Aktion ließen ihn daraufhin schnell zum Aushängeschild der von ihm mitbegründeten so genannten Spartakusgruppe werden. Wie kein anderer hatte er deutlich zu machen versucht, dass es bei diesem Krieg um keinen deutschen Verteidigungskrieg, sondern um einen von Deutschland ausgelösten imperialistischen Krieg handelte. Der Hauptfeind, so Liebknecht im Mai 1916, steht im eigenen Land: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung! Seine auf dem Berliner Potsdamer Platz ausgerufene 1.Mai-Parole kann in ihrer Bedeutung für die Stärkung und Entfaltung eines revolutionären Geistes innerhalb der deutschen Bevölkerung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Doch gleichzeitig sorgte gerade diese symbolische Aktion auch dafür, dass die daraufhin Liebknecht und andere treffenden Repressionen den bereits damals beginnenden Aufbau der Spartakusgruppe zum politischen Organisationszentrum einer neuen, kommunistischen Opposition nachhaltig störte und auf lange Zeit behinderte.
Erst die ihr Haupt machtvoll erhebende deutsche Revolution sollte den wegen Landesverrat einsitzenden Zuchthäusler Liebknecht Ende Oktober 1918 wieder befreien. Schnell wurde der Spartakist nun zum Führer des radikalen Flügels der deutschen Novemberrevolution, der am 9. November 1918 vergeblich die »freie sozialistische Republik Deutschland« ausrief, in breiten Teilen der deutschen Arbeiterschaft eine beeindruckende Verehrung genoss und die junge Kommunistische Partei in die revolutionären Wirren des Jahreswechsels 1918/1919, in den so genannten Spartakus-Aufstand führte (»Alle Macht den Räten!«), dessen Scheitern er und sehr viele andere schließlich mit dem Leben bezahlen mussten. Mit dem gewaltsamen Tod von Liebknecht und Luxemburg, von Kurt Eisner und Leo Jogiches, von Eugen Leviné, Hugo Haase und anderen verlor die deutsche Revolution ihre besten Köpfe. Und mit den weniger bekannten vielen Tausend Opfern der Aufstände und revolutionären Unruhen jener Zeit verlor sie einen Gutteil ihrer Aktivisten und Parteigänger. Abermals wurde eine linke Alternative nachhaltig behindert und verwirrt – und musste dafür diesmal mit dem Aufstieg jener Hitlerfaschistischen Barbarei bezahlen, die zuerst sie auf Jahrzehnte hinaus zerschlagen und dann viele Millionen von Europäern und das europäische Judentum vernichten sollte. Es war die deutsche Novemberrevolution, deren blutiges Scheitern die weiteren Weichen für das Jahrhundert unvorstellbarer Gewalt stellen sollte. Und mehr noch als Rosa Luxemburg oder andere war und blieb es Karl Liebknecht, der, weit über seinen Tod hinaus, als das Herz und Gesicht dieser deutschen Novemberrevolution angesehen werden sollte – verehrt von den einen und gehasst von den anderen.
»Karl Liebknecht. Der Name ruft Emotionen wach. Auch heute noch.« – So leitete vor nun fast dreißig Jahren Helmut Trotnow seine politische Biografie Liebknechts ein, die erste Gesamtdarstellung »aus nicht-kommunistischer Sicht«, wie er damals betonte (Karl Liebknecht. Eine politische Biografie, Köln 1980). In der Tat ist es verwunderlich, dass Leben und Werk eines Mannes, der solche Wirkung entfaltete und solche Emotionen freisetzte, auch Ende der 1970er Jahre, sechzig Jahre nach seinem gewaltsamen Tode so wenig aufgearbeitet war. Die DDR, die Liebknecht zum Bannerträger ihrer staatspolitischen Tradition verklärte – unter anderem mit einer jährlichen Großdemonstration zum Todestag am 15. Januar, die im neuen, vereinten Deutschland zur immerhin größten alljährlich wiederkehrenden Straßendemonstration der deutschen Linken avancierte –, hatte zwar seine Gesammelte(n) Reden und Schriften herausgegeben, doch sowohl die biografische wie werktheoretische Auseinandersetzung mit ihm war über hagiografische Vorarbeiten nicht hinausgekommen. Erst zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR, und immerhin weitere dreißig Jahre, nachdem der Westdeutsche Trotnow Liebknechts politische Biografie vorgelegt hatte, liegt nun, mit Annelies Laschitzas Buch über Die Liebknechts ein neuer Versuch der biografischen Gesamtdarstellung Liebknechts vor. Und Laschitza, bisher hervorgetreten durch ihre lebenslange Beschäftigung mit dem Leben und Werk Rosa Luxemburgs, knüpft dabei interessanterweise gerade dort an, wo Trotnow es damals für nicht mehr möglich hielt. Schrieb dieser, dass »der Großteil des Nachlasses von Karl Liebknecht als verloren gegangen anzusehen (ist)«, so belehrt ihn Laschitza nun eines Besseren, denn ihre Biografie wertet gerade den über all die Jahre in Ostberlin und Moskau liegenden Nachlass erstmals umfassend aus.
Laschitza nun bietet uns ein biografisches Bild Liebknechts, das an umfassender Detailliertheit wenig zu wünschen übrig lässt –zudem ausgesprochen gefällig geschrieben. Und doch habe ich in der Mitte des Buches zu Lesen aufgehört und musste mich überwinden, es erneut in die Hand zu nehmen. Nicht etwa, weil es, wie die einschlägigen Rezensenten des deutschen Feuilletons behauptet haben, das hagiografische Werk einer unbelehrbaren, einstmals realsozialistischen Wissenschaftlerin sei. Ganz im Gegenteil. Laschitza, die ehemalige Mitarbeiterin des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, gibt sich vom Dogmatismus alter Zeiten geläutert, ist, wie es in einer anderen Besprechung treffend hieß, verhalten selbstkritisch, und spart weder mit Distanz noch mit verhaltener Kritik an ihrem Protagonisten. Dass sie sich ihre grundsätzliche politische Sympathie für Liebknecht erhalten hat, kann nur jemand kritisieren, der den Besiegten der Geschichte demonstrativ auch noch ihre letzte Würde nehmen möchte. Nein, wenn es etwas zu kritisieren gibt an dieser neuen Biografie, dann ist es gerade ihr bemerkenswert unpolitischer Charakter.
Vom weltgeschichtlichen Drama des deutschen Wilhelminismus erfahren wir in diesem Buch ebenso wenig wie von den schicksalsträchtigen Kämpfen und Debatten der deutschen Arbeiterbewegung vor dem Zusammenbruch des deutschen Reiches. Wir erfahren von der Leidenschaftlichkeit Liebknechts und davon, dass sich diese Leidenschaften auf die Politik und die Wissenschaft richteten (und auf die Frauen). Aber damit ist es auch schon fast vorbei. Mit der Gewissenhaftigkeit einer Buchhalterin – wie gesagt: immerhin einer, die gut schreiben kann – bekommen wir das ganze Panorama Liebknechts geboten. Doch es gleicht mehr einem Familienroman, besser: einem Tagebuch der Familie Liebknecht, das die Politik nur insofern behandelt, als es von einem leidenschaftlichen Politiker handelt.
Kundig stellt Laschitza die politischen Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen Vater Wilhelm und Sohn Karl dar, doch sie belässt es bei einer bloßen Auflistung ohne jede Analyse – und bewegt sich dabei gelegentlich am Rande des Kitsches. So wenn sie bspw. schreibt, dass sich in ihm »die Leidenschaftlichkeit des Vaters mit dem gutmütigen Naturell der Mutter und deren freimütigem Streben nach intellektueller und musischer Selbstverwirklichung (vereinte)«. Sie zitiert seine Worte, dass er ja »sozusagen im Parteileben aufgewachsen« sei und die Parteidisziplin »mit der Muttermilch eingesogen« habe. Doch sie diskutiert nicht, was das für seine Biografie bedeutet hat. Sie diskutiert auch nicht, dass und wie dieses individuelle Leben, eben weil es mehr war als ein nur individuelles, zu einem politisch-kollektiven Leben wurde, als gerade Liebknecht den gordischen Knoten einer in der klassischen Arbeiterbewegung gründlich falsch verstandenen Parteidisziplin durchbrach und mit seiner Verweigerung der Zustimmung zu den Kriegskrediten ein politisches Zeichen setzte, das die Menschheit so lange faszinieren wird, wie sie am radikal-humanistischen Traum einer nicht-kriegerischen Welt festhält.
Treffend erwähnt Laschitza Liebknechts Kontakte zur russischen Emigration, und dass ihn diese Erfahrungen eines gelebten Internationalismus darin bestärkten, »sich auch in seiner Partei mit mehr Elan für ein energischeres Auflehnen gegen die Innen- und Außenpolitik der herrschenden Kreise in Deutschland einzusetzen«. Aber sie erklärt nicht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, denn was als reine Ethik erscheint, war politisch-strategisch bestimmt – »nichts anderes als die außenpolitische Kehrseite des innenpolitischen Kampfes gegen Preußen« wie Helmut Trotnow treffend geschrieben hat. Um jedoch ihre Leserschaft über diesen Zusammenhang aufzuklären, hätte sie über den sich damals mächtig entwickelnden und vernetzenden Weltkapitalismus und seine imperialistischen Begleiterscheinungen schreiben müssen. Das mag im neuen Deutschland nicht gerade opportun sein – wäre dem Gegenstand allerdings mehr als angemessen.
Sie erzählt uns von dem begnadeten Redner in und außerhalb des Parlaments, wie er gegen kleinkarierte Möchtegern-Sozialisten und großindustrielle »Leistungsträger« – wie es heute wieder so unangemessen selbstverständlich heißt – polemisiert, und von dessen parlamentarischem »Meisterstück«, dem Kampf gegen die Rüstungsindustriellen Krupp und Co. Doch auch hier wird die bloß buchhalterische Erwähnung nicht durch eine sich gerade heutzutage anbietende exemplarische Behandlung vertieft.
Die Oberflächlichkeit im Kleinen hat Konsequenzen auch für das große Ganze. Laschitza möchte Liebknecht aus dem Schatten Rosa Luxemburgs herausholen und vor der Versteinerung zum linken Säulenheiligen bewahren. Dazu müsste man eine politisch aufgeklärte Interpretation des Liebknechtschen Lebens und Werks bieten. Aktuell scheint Liebknecht für Laschitza jedoch nur in seinem vermeintlichen »Bestreben nach Frieden, Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und internationaler Solidarität«, in seinem angeblichen Plädoyer »für eine demokratische und sozial gerechte Ausländerpolitik«, und weil er sich »konsequent für die Interessen seiner Wähler und für eine demokratische und friedliche Perspektive Deutschlands eingesetzt« habe. Liebknecht verdiene Beachtung, weil »er als Sozialist und Antimilitarist von internationalem Rang bis zuletzt konsequent blieb, sich beruflich, politisch und privat zum Teil euphorisch und risikobereit auszuleben versuchte, ohne sich an Konventionen zu stören, vor Konflikten zu scheuen und auf Dauer seine Liebenswürdigkeit und Lebensfreude zu verlieren (…) Menschen, die sich ähnlich engagiert und mutig wie er gegen Kriegspolitik und Rüstungswahn, gegen Völkermord und Menschenrechtsverletzungen, gegen Kulturbarbarei, Religionsmissbrauch und Naturverwüstungen auflehnen wollen, können in seinem Wirken viel Anregung finden und werden sich in ihrer Opposition durch Liebknechts Worte bestärkt fühlen: (…) ›Nur nicht zuwenig! Nur nicht zu spät!‹
Auf diese Weise bis zur Unkenntlichkeit weichgespült, soll die Aktualität Liebknechts offensichtlich in dessen radikalem Nonkonformismus eines »Ich will alles und zwar sofort« liegen. Mit den Mythen des Nonkonformismus lässt sich aber keine Aktualität Liebknechts mehr begründen. Es wissen bereits zu viele, dass solcherart Unersättlichkeit die bürgerliche Gesellschaftsform nicht überwindet, sondern eher vollendet – nicht zuletzt im Rausch von Sex and Drugs and Rock’n Roll.
Dass auch Liebknecht davon nicht frei war, deutet Laschitza mit der intimen Kenntnis der Nachlassverwalterin freimütig an. So liebevoll und umsichtig er sich seinen Kindern gegenüber in den wenigen Momenten zeigte, die ihm sein rastloses politisches Wirken ließ, so unausgeglichen und oftmals gereizt sei der von sich selbst Überzeugte gewesen, der einmal betonte, dass ihn das chaotische Erzeugen und Gebären mehr interessiere als das systematische Ordnen und Gliedern. Die Folgen dieser emotionalen Höhen und Tiefen ließ er nicht zuletzt an seiner ersten Frau aus. Denn während die sich um Küche und Kinder zu kümmern hatte, kümmerte er sich – von inneren Krisen gepeinigt, wie Laschitza zu berichten weiß – um andere Frauen. Sie scheint sogar Verständnis für seine diesbezüglichen Lügen und Versteckspiele zu haben und spricht von ihm als einem Opfer: »Im Frühjahr 1910 vermochte er dem Liebeswerben einer anderen Frau nicht zu widerstehen.« Man hätte sich hier von der Biografin ein wenig mehr von dem gewünscht, was ihr Objekt zweifelsohne auszeichnete, denn Liebknecht war jede falsche Ehrfurcht vor linken Autoritäten, heißen sie auch Marx, Lenin oder Trotzki, in bemerkenswertem Ausmaß fremd.
Laschitza scheut sich schließlich auch, Liebknechts ausgesprochen unorthodoxe Versuche an einer sozialistischen Sozialphilosophie, seine nachgelassenen Studien über die Bewegungsgesetze der gesellschaftlichen Entwicklung, angemessen zu behandeln. Kann oder soll man Karl Liebknecht in die Ahnengalerie des Marxismus einreihen oder wird damit beiden Gewalt angetan? Immerhin eine die Liebknecht-Literatur bewegende Frage. Und was heißt es eigentlich für ihn als Denker wie für die deutsche Revolution als solche, wenn ein solch unorthodoxer – mit dem marxistisch ›richtigen‹ Denken nur schwer vereinbarer – Denker (der er eben auch gewesen ist) zum sozialistischen Revolutionsführer werden kann? Wie vermitteln sich hier Theorie und Praxis? Das sind spannende Fragen, die ihre politische wie theoretische Aktualität nicht verleugnen können, von Laschitza aber nicht angesprochen werden.
Helmut Trotnow zeigte sich Ende der 1970er Jahre gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen von Liebknecht. Auch wenn er ihm allenfalls historische Bedeutung zusprach, hielt er ihn trotzdem für aktuell, vor allem deshalb, »weil bis heute die Frage, ob und wie konsequente Reformpolitik in einem gegebenen gesellschaftlichen Kontext gewaltlos verwirklicht werden kann oder zwangsläufig zur Revolution führen muss, immer noch einer schlüssigen Antwort harrt«. Für ihn war Liebknecht ein radikaler Reformist, der jedoch die Reformpolitik nicht als modernen Verwaltungsakt, sondern als Mittel der Aufklärung und Selbsttätigkeit einer unterdrückten und ausgebeuteten proletarischen Bevölkerungsmehrheit verstand. Trotnows damalige These, dass Liebknecht damit der SPD näher stehe als der SED, darf getrost als überschießendes Bewusstsein der Juso-Euphorie der 70er Jahre gelten. Die Frage selbst jedoch bleibt aktuell. Und dass die im Umfeld der neuen Linkspartei schreibende Annelies Laschitza sie nicht aufgreift, verblüfft ein wenig.
Liebknechts politische Theorie und Praxis werden bei ihr weitgehend in humanistische Ethik aufgelöst. Eine Tendenz, die die Ex-ML-Sozialistin interessanterweise mit dem eher der Neuen Linken zuzurechnenden Ossip Flechtheim gemeinsam hat, der Liebknechts Aktualität noch Mitte der 1980er Jahre in dessen humanistischem Nonkonformismus ausmachte (Karl Liebknecht zur Einführung, Hamburg 1985). Flechtheims damaliges Lob der Liebknechtschen »Einheit von Bekenntnis und Tat, das Ineinander von Glauben, Wollen und Handeln«, Liebknechts Abkehr vom »oberflächlichen Opportunismus«, von der »mutlose(n) Resignation« und dem »karriereorientierte(n) Bürokratentum« ist vielen politisch Gesinnten sicherlich auch heute noch sympathisch. Doch kann solcherart humanistischer Nonkonformismus kaum den Schleier des Skeptizismus durchbrechen, der sich wie selbstverständlich über den heutigen Alltagsverstand gelegt hat. Liebknechts zweifellos vorhandener Nonkonformismus – im Mai 1916 gab er vor Gericht zur Person an: »meine Konfession: Dissident« – ist durchaus nicht gering zu schätzen. Nur kann er kaum noch als solcher Aktualität reklamieren in einer Zeit wie der unseren, in der ein nonkonformistischer Konformismus den postmodernen Betrieb nachhaltig ölt. Auch der Liebknechtsche Humanismus ist aktueller als es der noch heute nachwirkende antihumanistisch aufgeklärte Zeitgeist der 70er und 80er Jahre wahr haben wollte. Er müsste eben ›nur‹ materialistisch aufgeklärt werden.
»Wer heute dem Leser Karl Liebknecht näher bringen will, wird sich fragen müssen, ob diese Gestalt nicht schon ganz und gar einer unwiederbringlichen Vergangenheit angehört«, schrieb Flechtheim vor einem Vierteljahrhundert. Als Ganzes genommen, als gleichsam individuelles Gesamtkunstwerk, scheint mir die fehlende Aktualität Liebknechts fast schon selbstverständlich, denn der »Mensch in seinem Widerspruch« – wie schon Karl Radek Liebknecht 1919 eindringlich charakterisierte – ist nur aus der damaligen Gemengelage der gesellschaftlichen Zustände und ihren spezifischen Widersprüchen zu verstehen. Und so wie die spezifisch deutsche Gemengelage von wilhelminischem ›Ancien Régime‹ und bürgerlich-kapitalistischer Dynamik selbst in der Geschichtswissenschaft nur schwer zu unterscheiden war und ist, so lassen sich die spezifischen Widersprüche des damaligen oppositionellen Denkens und Handelns erst auf ihre jeweilige Aktualität hin befragen, wenn der in ihnen sich geformte Knoten historischer Zusammenhänge gelöst und mit einem aufgeklärten Bewusstsein von den zeitgenössischen Formen und Strukturen mit unserer Gesellschaftsformation konfrontiert wird. Erst dieser doppelte Blick erlaubt die Frage nach jenen Aspekten des Liebknechtschen Denkens und Wirkens, die ein anhaltendes oder gar ein neues Interesse wert wären.
Da wäre zuallererst der Liebknechtsche Anti-Militarismus, der im pazifistisch gesinnten Nachkriegsdeutschland der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts als weitgehend antiquiert galt, mit der Rückkehr des militärischen Interventionismus auch ins neue Deutschland aber neue Aktualität bekommen hat. Liebknechts Anklage des Militarismus als eines »Würgeengels der Kultur«, der die Zivilisation barbarisiere und die Mittel eines wahrhaftigen Fortschritts fresse, ist so erfrischend traditionell wie seine Darstellungen, auf welchen Wegen eine in den bürgerlichen Alltag einsickernde soldatische Erziehung die demokratisch-selbsttätige Wahrnehmung von individuellen und Klassen-Interessen nicht nur verhindert, sondern geradezu zurückentwickelt. In Zeiten wie den unseren, in denen der Krieg bereits tief in die Eingeweide der Gesellschaft eingedrungen und die westliche Massenkultur zu einer »Art Trainingslager für soldatische Verhaltensformen« geworden ist (Tom Holert/Mark Terkessidis: Entsichert. Krieg als Massenkultur im 21.Jahrhundert, Köln 2002), fänden heutige Ideologietheoretiker reichlich Schulungsmaterial bei Liebknecht. Und Kritiker des humanitären Interventionismus dürften sich durch dessen (von Laschitza zitiertes) Einmaleins des Sozialismus bestätigt fühlen, denn ein »bis in die innerste Seele international und klassenkämpferisch gesonnener Sozialdemokrat kann nie ein williges Werkzeug des Militarismus sein, nicht im Frieden oder im Kriege gegen den inneren Feind noch im imperialistischen Kriege gegen den äußeren Feind; nicht in der Armee und nicht außerhalb der Armee« (Hervorhebung: Liebknecht).
Auch die Aktualität des von Liebknecht im Alltag gelebten Internationalismus scheint mir offensichtlich. Dass er seinen Internationalismus nicht nur als Akt einer Solidaritätsarbeit verstanden hat, sondern als eine gemeinsame, Grenzen überschreitende Strategie-Debatte, verweist auf sein tiefgreifendes Verständnis des damals aufkommenden kapitalistischen Weltsystems. Es war dieses Verständnis weltpolitischer Zusammenhänge, das Liebknecht auf besondere Weise – und Rosa Luxemburg vergleichbar – auch für das weltgeschichtliche Drama des weltrevolutionären Prozesses nach dem Ersten Weltkrieg sensibilisierte. Zu Recht sah er 1918/19 in der deutschen Revolution sowohl »Angel-, Schlüssel-, Hebelpunkt der Weltrevolution«, denn nur sie wäre »die einzig mögliche Rettung für die russische Revolution« gewesen. Es war dieses weltpolitische Verständnis, dass sich bei ihm mit einer durchaus realistischen Einschätzung der fehlenden Reife des Klassenbewusstseins der deutschen Arbeiterklasse kombinierte, und seinen Interventionen in die deutsche Revolution ihren Ton scheinbarer ethischer Verzweiflung gab: »Alles, alles kommt auf das deutsche Proletariat an. Keine Anstrengung ist zu groß, ist groß genug. (…) Andere mögen ihr ›Nur nicht zuviel! Nur nicht zu früh!‹ plärren. Wir werden bei unserem ›Nur nicht zu wenig! Nur nicht zu spät!‹ beharren.«
Es ist sehr viel argumentiert und polemisiert worden gegen die in diesem Diktum steckende Vorstellung von Politik als Wille und Tat. Und doch sollte ihr rationaler Kern nicht übergangen werden, denn keine revolutionäre Entwicklung kann sich in sozialistisch-emanzipativem Sinne entfalten ohne die bewusste Setzung eines hegemoniefähigen Zieles und den (kollektiven) Entschluss zur Aktion; ohne die Aufklärung der zur Erreichung dieses Zieles notwendigen, alles andere als einfachen Dialektik von Weg, Mittel und Ziel; und ohne das Verständnis, dass ein partielles Vorgreifen revolutionärer Prozesse an einem Ort über deren Wirkung an anderen Orten auch wieder Rückwirkungen für das weitere Vordringen der eigenen revolutionären Prozesse zeitigt – im Guten wie im Schlechten. Es kommt eben auf die Zusammenhänge an, oder marxistisch gesprochen: auf die Totalität des weltrevolutionären Prozesses. Liebknechts spätes Stakkato des Voluntarismus führt deswegen Luxemburgs frühen Hinweis fort, dass sozialistische Revolutionen gleichsam naturgemäß zu früh kommen. Weil die sozialistische Umwälzung, weil der Kampf um die gesellschaftliche und politische Macht, so Luxemburg bereits in ihrer Bernstein-Kritik Ende des 19. Jahrhunderts, gar nicht anders als »zu früh« beginnen könne, seien die »verfrühten« Angriffe des Proletariats »ein (…) sehr wichtiger Faktor (…), der die politischen Bedingungen des endgültigen Sieges schafft, indem das Proletariat erst im Laufe jener politischen Krise, die seine Machtergreifung begleiten wird, erst im Feuer langer und hartnäckiger Kämpfe den erforderlichen Grad der politischen Reife erreichen kann, der es zur endgültigen großen Umwälzung befähigen wird. So stellen sich denn jene ›verfrühten‹ Angriffe des Proletariats auf die politische Staatsgewalt selbst als wichtige geschichtliche Momente heraus, die auch den Zeitpunkt des endgültigen Sieges mit herbeiführen und mitbestimmen. Von diesem Standpunkt erscheint die Vorstellung einer ›verfrühten‹ Eroberung der politischen Macht durch das arbeitende Volk als ein politischer Widersinn, der von einer mechanischen Entwicklung der Gesellschaft ausgeht und einen außerhalb und unabhängig vom Klassenkampf bestimmten Zeitpunkt für den Sieg des Klassenkampfes voraussetzt.«
Als intellektueller Erbe des Marxismus der Zweiten Internationale findet sich auch bei Karl Liebknecht das oftmals mechanische Nebeneinander von vermeintlich naturgesetzlichem Gesellschafts- und Revolutionsverständnis auf der einen und einem diesen ergänzenden ethischen Voluntarismus auf der anderen Seite. Bildete Eduard Bernsteins Denken die eine Seite dieser historischen Dialektik, steht Liebknechts Denken für die andere. Die Tatsache jedoch, dass die spezifische Verknüpfung der Elemente eine historisch bedingt ungenügende gewesen ist, entledigt nicht der Aufgabe, die Elemente als solche zu erkennen, einzuschätzen und unter heutigen Bedingungen neu zu verknüpfen. So sehr also die Geschichte Liebknechts die historischen Grenzen seines vorauseilenden Bewusstseins aufzeigt – Laschitzas Buch findet gerade in der Schilderung der für dieses vorauseilende Bewusstsein verhängnisvollen Kriegs- und Revolutionsjahre seine Originalität: eine solche Darstellung fehlte bisher fast ganz –, so deutlich wird gerade bei ihm die Fakten schaffende Zentralität eines revolutionären Bewusstseins, das immer auch überschießendes Bewusstsein ist. »Wann die Gesellschaft für die soziale Revolution reif ist«, formulierte er in seinen Zuchthaus-Notizen von 1918, »hängt nicht nur vom Grade ihrer wirtschaftlichen Entfaltung ab, sondern von ihrer gesamten sozialen Entwicklung im weitesten Sinne, vor allem auch von dem Grade, den das Bewusstsein, die Einsicht, der Wille, die Entschluss- und Aktionskraft des Proletariats erreicht hat, von der geistigen, moralischen, psychischen Stufe der arbeitenden Massen.«
Es scheint mir deswegen kein Zufall, dass sich gerade Liebknecht, wie Laschitza einmal bemerkt, in einem Ausmaße geistreich und undoktrinär geäußert hat, wo es um die Rolle des Bewusstseins im gesellschaftlichen Leben, um die Psychologie und das projektive, aktive Element der Religion geht, das ihn von den meisten seiner vulgärmaterialistischen Zeitgenossen deutlich unterscheidet. Erst vor diesem Hintergrund verliert Liebknechts Sozialismusverständnis als einer »Entstehungs- und Kampfform dieses neuen allumspannenden Humanismus« seinen scheinbar traditionalistischen, ethisch-unverbindlichen Beigeschmack. Und erst vor diesem Hintergrund erhält Liebknechts politisches Credo seine ganze Tiefe: »Der Partei dienen heißt längst nicht immer: kleine oder mäßige Reformen für die Arbeiterschaft erwirken. Es kommt darauf an, wie sie erwirkt werden; was nützte es der Sozialdemokratie, wenn sie eine ganze Welt aller erdenklichen Reförmchen gewänne und nähme doch Schaden an ihrer Seele, das heißt: würde verwirrt, verkleinlicht, kleinmütig und selbstzufrieden, verlöre ihr Edelstes und Bestes, den Elan ihrer revolutionären Energie, die auch den Boden für Reformen am fruchtbarsten düngt – man vergleiche nur die Ernte der Sozialgesetzgebung bis zum Jahre 1890 und seitdem!« Und man vergleiche nur die reformatorische Ernte der radikalen Minderheitenrevolte von 1968ff. mit der Ernte, die eine auf Anerkennung und Mitregierung orientierte zeitgenössische linke Politik seit nun 30 Jahren einfährt – sei es in Deutschland, Italien oder anderswo.
Liebknechts Ziel war trotz des ihn gelegentlich auszeichnenden parlamentarischen Pragmatismus »nicht die Erringung politischer Macht per se, sondern die Höherentwicklung der Menschheit mit Hilfe der Emanzipation des Proletariats«, wie schon Trotnow zu formulieren wusste – der jedoch den daraus abgeleiteten Antikapitalismus und damit letztlich auch den Politiker Liebknecht explizit als überholt betrachtete. Liebknechts Ziel speiste sich aus einem anderen Bezugssystem als dem der herrschenden Rationalität. Er suchte nicht die Anerkennung der Herrschenden, sondern die der Beherrschten. Sein revolutionärer Elan schöpfte eben nicht aus einer unverbindlichen kulturrevolutionären Energie, sondern aus der Erfahrung einer Klassengesellschaft, die sich damals noch wenig Mühe gab, ihren Klassencharakter zu verbergen. Liebknechts Elan, seine ganze sprichwörtliche Unversöhnlichkeit – er selbst hatte sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges das Pseudonym Implacabilis (unversöhnlich) gegeben – findet seine Grundierung in einem klassenpolitischen Denken und Handeln, das, nicht zuletzt in seiner deutschen Heimat, lange Jahrzehnte als historisch überholt galt. Und die Frage nach seiner Aktualität steht und fällt deswegen mit der Frage nach der Aktualität dieses klassenkämpferischen Ansatzes.
Die Verhältnisse von Krieg und Frieden, von Reform und Revolution, von Parlamentarismus und außerparlamentarischer Bewegung, von Klassengesellschaft und oppositioneller linker Politik – wie sehr haben sie sich seit Liebknechts Zeiten verändert und wie sehr sind sie sich doch dabei gleich geblieben. Karl Liebknecht, auch darin ein intellektuelles Kind des Marxismus der Zweiten Internationale (der auf einer weitgehenden institutionellen Ausgrenzung der organisierten Arbeiterbewegung beruhte), fehlte das Gespür für die strukturelle Rolle und Eigenlogik von gesellschaftlichen Organisationsformen und Institutionen. Das beschert ihm auch heute noch eine eigenartige Präsenz, denn an dieser gesellschaftspolitischen Ausgrenzung einer sozialistischen Linken hat sich in Deutschland anscheinend nicht viel geändert. Gerade der sich in Liebknecht wieder erkennende radikale Einzelgänger ist weniger Lösung als Teil des herrschenden Dilemmas, Spiegelbild der Tatsache, dass seinesgleichen nur außerhalb der herrschenden Institutionen und Organisationen, nur in der Gegenwelt der Arbeiterorganisationen und -institutionen, wirken konnte. Mit der weitgehenden Auflösung dieser proletarischen Gegenwelten und der daran sich anschließenden Formierung oppositioneller Politikformen zu Jobmaschinen und bürokratischen Dienstleistern des herrschenden Systems haben sich die Bedingungen zeitgenössischer linker Politik ebenso wenig zum Einfacheren entwickelt wie die Diskussion, was sich von Liebknechts Erfahrungen und Konzepten noch übernehmen lässt.
Annelies Laschitzas Buch führt diese Diskussionen nicht. Es gibt sich bescheiden und erscheint als solide historische Arbeit. Das mag vielen ihrer Leserinnen und Lesern reichen – und ist von der linken Presse weitgehend unkritisch aufgenommen worden. Ob es seinem Gegenstand angemessen ist, darf jedoch bezweifelt werden.