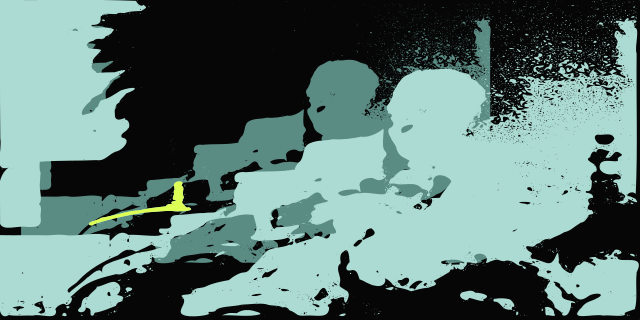von Rolf Steltemeier und Heinz Theisen
Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten sind die größten Entwicklungshilfegeber der Welt. Der Einsatz dieser Mittel sollte sich jedoch mehr an der Realität orientieren. Entwicklungspolitik scheitert, wenn die Nutznießer patriarchalische Familienbünde oder etablierte Oligarchien sind. Weiterführend sind vielmehr freiheitliche Perspektiven insbesondere bei der Entwicklung der Privatwirtschaft – sie stellt einen wichtiger Pfeiler dar, um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen.
Weltweit gibt es rund sechzig rechtsstaatliche Demokratien und knapp fünfzig eindeutige Diktaturen. Bei den neunzig verbleibenden Regimen handelt es sich um Hybride, so genannte ›Democraduras‹ oder ›Demokraturen‹, Regime in der Grauzone zwischen Demokratie und Diktatur. Sie sind oft sogar repressiver als offene Diktaturen. Gleichzeitig finden sich autoritäre Tendenzen in liberalen Demokratien, aber zugleich auch freiheitliche Bewegungen in Belarus, Russland, Myanmar und Uganda.
Ein einheitliches Ziel der Geschichte ist demnach nicht zu erkennen. Hinzu kommt, dass ein westliches Verständnis von Staatlichkeit, wie es sich in Europa seit dem 17. Jahrhundert herausgebildet hat, oft nicht geeignet ist, um politische Realitäten an anderen Orten zu beschreiben. Ebenso lassen sich unsere Annahmen über bürokratische Abläufe und rechtsstaatliche Mechanismen, die auch im globalen Norden oft in idealistischer Absicht überhöht werden, nicht ohne weiteres auf andere Gesellschaften übertragen.
Oligarchien stehen quer zur gesellschaftlichen Entwicklung
Das »eherne Gesetz der Oligarchie« (Robert Michels) spielt in traditionalistischen Stammeskulturen eine noch größere Rolle als in modernen Gesellschaften. Es ruht dort sogar auf ethischen Fundamenten, denen zufolge Nächstenliebe ausschließlich in den Nahgemeinschaften Geltung hat. Endlose Klagen über ›die Korruption‹ übersehen diese kulturellen Prägungen, weil sie dem westlichen Universalismus entgegenstehen. Entwicklungspolitik scheitert, wenn sie den oligarchischen »Vermachtungstendenzen« (Walter Eucken) nicht entgegenwirkt. Oft befördert sie diese sogar noch, wenn die Nutznießer keine Bürger, sondern kollektive Machtstrukturen sind, seien es patriarchalische Familienbünde oder etablierte Oligarchien.
Die Globalisierung war eigentlich als Weg zum marktwirtschaftlichen Wettbewerb gedacht. Wenn jedoch aus Afrika jedes Jahr fast so viel Kapital in illegalen Finanzströmen abfließt wie an öffentlicher Entwicklungshilfe und ausländischen Direktinvestitionen zusammen herein kommen, befördert sie die oligarchischen Strukturen, die Entwicklung letztendlich hemmen. Die Situation wird verschärft, wenn diese Oligarchien sich auch noch weltweit vernetzen und die Chancen der Globalisierung nutzen, um ihre eigene Macht wirtschaftlich und politisch abzusichern.
Romantiker und Regressive
Im Westen dominiert seit langem eine Exotisierung des globalen Südens, welcher primär als ›unser‹ Opfer stilisiert wird. In den entwicklungspolitischen Programmen aller Parteien fehlt es nicht an Aufforderungen, dass ›wir mehr tun müssen‹, um unseren Wohlstand und unsere Werte zu universalisieren. Diese nur dem Anschein nach kritische Selbstverortung nimmt den Entwicklungsländern Eigenverantwortung ab und verhindert gleichzeitig ein Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Die Täterattitüde des Westens befördert die Opferattitüde im globalen Süden.
Beim globalistischen Glauben, dass sich hinter allen Gegensätzen Gemeinsamkeiten der ›Einen Welt‹ verbergen, handelt es sich um eine neue Form der Romantik. Die Folgen dieser Realitätsverleugnung sind erheblich: Kulturrelativismus nach innen und politischer Universalismus nach außen drohen die Selbstbegrenzung und Selbstbehauptung des Westens zu unterminieren.
Umgekehrt suchen die Verlierer der Weltoffenheit ihr Heil in regressiv-kollektivistischen Verengungen, seien sie religiöser oder ethnisch-nationalistischer Art. Islamisten, Nationalisten und Separatisten versprechen den Zukurzgekommenen statt globaler Teilhabe mehr Schutz. Wo diese Haltung um sich greift, endet sie unweigerlich in Nullsummenkonflikten.
Zu den gängigen globalistischen Illusionen gehört auch die Hoffnung, dass es sich bei ›dem‹ Islam ausschließlich um eine Religion handelt. Gemäß der Kairoer Erklärung der Menschenrechte von 1968 sind in ihm aber die Menschenrechte den Gottesgesetzen untergeordnet und gelten nur im Rahmen der Scharia. In seinen dominantesten Ausprägungen, wie sie sich zum Beispiel in den Theokratien des Iran und Saudi-Arabiens, aber auch in der Terrorherrschaft des IS zeigen, ist der Islam eine politische Religion und steht daher wesensmäßig einer säkularen Trennung der Gewalten und einer Ausdifferenzierung der Funktionssysteme entgegen.
Wie lange Zeit auch die christliche Religion verhindert dieser Islam nicht zuletzt eine moderne Familienplanung und ist daher für die desaströse Bevölkerungsexplosion in Afrika mitverantwortlich. Im ›Dialog der Kulturen‹ ist es mit Toleranz, Empathie und Versöhnung nicht getan. Vielmehr gehören die Hindernisse von Entwicklung in den Mittelpunkt der Debatten. Die Unfreiheit der Frauen in traditionellen Kulturen darf auch unter dem Entwicklungsparadigma niemals toleriert werden.
Die Demokratie ist nur das Dach
Die Demokratie ist das Dach, welches nur auf das Fundament von Säkularität und Individualität, Rechtsstaat und Marktwirtschaft, Bildung und Ausbildung aufgesetzt werden kann. Ihre voraussetzungslose Einführung multipliziert mit der Vielfalt von Parteien oft noch die Zahl der Akteure, die ihr Land abwechselnd ausplündern. Und sie ermöglicht die Legitimation von Muslimbrüdern und Islamisten, die dann – wie heute in der Türkei – Freiheitsrechte abschaffen. In den palästinensischen Gebieten führten freie Wahlen zum Sieg der islamistischen Hamas, danach zu Bürgerkrieg und Spaltung. In Uganda täuschen Wahlen über die faktischen oligarchischen und diktatorischen Strukturen hinweg.
Die schönen Visionen von globaler Solidarität und Nachhaltigkeit müssen mit den Erfahrungen der Geschichte abgeglichen werden. Wie voraussetzungsreich demokratischer Fortschritt ist, zeigen in Europa die mühsam erkämpften Freiheitsrechte. Demokratie ohne Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Freiheit droht entweder oligarchische Tendenzen zu verstärken oder in einer Pöbelherrschaft zu enden. Erst die säkulare Trennung von Religion und Politik schuf die Möglichkeiten zur Freisetzung von Eigenlogik und Eigendynamik der wissenschaftlich-technischen Funktionssysteme und schließlich zu mehr individuellen ökonomischen und politischen Freiheiten.
In der wissensbasierten Zivilisation und mithilfe revolutionärer Kommunikationsmöglichkeiten gibt es heute aber neue Chancen, diese Fortschrittsprozesse abzukürzen. Längst ist der Besitz von Know-how wichtiger als eine Herrschaft über möglichst viel Territorien und Menschen. Wissen ist zum wichtigsten Rohstoff geworden. Alle anderen Rohstoffe und Energieträger sind endlich, je mehr man davon braucht, desto weniger hat man. »Wissen ist dagegen eine wachsende Ressource, je mehr man davon nutzt, desto mehr hat man« (Yuval Harari). Ein Zuwachs des Wissensbestandes kann sogar zu mehr Rohstoffen und zu billigerer Energie führen. Ausgebildete Menschen sind heute die wichtigste Ressource.
Ausbildung und Bildung werden darüber in einer wissensbasierten Welt auch zu den wichtigsten Teilhabe- und Menschenrechten. Aber die Studierenden müssen ihren Beitrag zu einem neuen Realismus leisten. Ihre Ausbildung sollte in der Regel auch privatwirtschaftlich verwertbar sein. Insbesondere geistes- und sozialwissenschaftliche Studiengänge sollten durch realwirtschaftliche Erfahrungen flankiert werden, um nicht in einer Sackgasse zu enden. Auch wenn diese Form der »Elitenüberproduktion« (Peter Turchin) nicht zwingend in den oft zitierten Niedriglohnsektor führt, so endet sie doch oft in den erdrückenden Abhängigkeiten der Patronagesysteme von Wissenschaft und Wirtschaft.
Emigration und Integration im Rahmen einer Deglobalisierung
Jungen Menschen, die keinen Platz in den etablierten Oligarchien finden, bleibt oft nur die Emigration. Aber auch diese führt in den meisten Fällen nur zu randständigen Existenzen und nicht zum Status eines Wirtschafts- und Staatsbürgers. Die beispiellose Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Integrationsversuche in Deutschland wurde von Migrationswissenschaftlern wie Paul Collier sogar als Politik des »kopflosen Herzens« bezeichnet, die in vielen Fällen einen »Brain drain« betrieben habe und zudem ein Heer von nicht integrierten Verlierern zu produzieren droht, denen staatsbürgerliche Teilhabe sowohl in ihren Heimatländern als auch in den Aufnahmeländern verwehrt wird.
Europa hätte in das Know-how in den Flüchtlingslagern des Nahen Ostens investieren sollen, damit die Menschen nach dem Krieg entweder mit ihren erworbenen Kompetenzen als Fachkräfte in ihre Heimat zurückkehren oder im Rahmen einer geordneten Migrationspolitik als gelernte Kräfte in die Welt aufbrechen könnten. Mit dem Aufbau von Sonderwirtschaftszonen wären dann bevorzugte Handelsbedingungen zu verbinden gewesen. Für diese Umwandlung von Brain-Drain in Brain-Circulation wären die kommunikationstechnischen Bedingungen besser denn je geeignet.
Die Rolle des Staates und der Europäischen Union
Freiheitliche Entwicklungsperspektiven erfordern neben der wirtschaftlichen Emanzipation einen Staat, der auch Einzelrechte und nicht nur Gruppeninteressen schützt. Eine ›staatsbürgerliche Entwicklungspolitik‹ wird daran gemessen werden, inwieweit sie Oligarchisierung verhindert und Staatsbürgertum stärkt.
Wie die ›Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung‹ (UNIDO) zeigt, ist gerade die Entwicklung der Privatwirtschaft durch Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Technologieaustausch ein wichtiger Pfeiler, um individuelle Akteure, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen.
Im Gegensatz zum ›Brain-Drain‹ sollen die Nutznießer dieser kooperativen Form der Entwicklungspolitik die wirtschaftliche und politische Entwicklung ihres eigenen Landes befördern. Und nur darüber kann auch das Ziel der europäischen Nachbarschaftspolitik erreicht werden: wirtschaftlicher Wohlstand, eingebettet in stabile Rechtsstaatlichkeit mit der Perspektive einer demokratischen Entwicklung.
Unterdessen hat sich im völlig blockiert scheinenden Nahostkonflikt in den Verträgen zwischen arabischen Staaten und Israel der Vorrang der wissensbasierten Zivilisation über Differenzen der Kultur, Nation und Religion durchgesetzt. Plötzlich geht es nicht mehr um den Besitz Heiliger Berge und einer eigenen Fahne für die Palästinenser, sondern um die Zusammenarbeit bei Landwirtschaft, Forschung, Tourismus und gegen Desertifikation und Terror.
Man hat nicht den Eindruck, dass diese kopernikanische Wende vom Kulturalismus zu den Funktionsbedingungen der Zivilisation von Europas Politikern hinreichend wahrgenommen wird. Sie argumentieren nämlich immer noch, ebenso wie die zahllosen NGOs, im Rahmen der Überhöhungen von identitären Gemeinschaften, die dann als Opfergruppen von erfolgreicheren Staaten abgegrenzt werden.
Noch immer schwärmen die Europäer von einem ›Multilateralismus‹ im Sinne eines gemeinsamen globalen Handelns auf der Grundlage gemeinsamer Prinzipien. Doch mit einem Großteil der Regime auf der Welt teilen wir eben keine gemeinsamen liberalen Prinzipien. Mit ihnen wird Zusammenarbeit nur in bestimmten Bereichen gelingen, während hinsichtlich anderer Felder umso mehr die Unterschiede bedacht und oft auch Grenzen gezogen werden müssen. Darüber würde die Einsicht in eine notwendige Deglobalisierung wachsen und der Radius europäischer Politik zu einem realistischen Maß finden. Europa wird nicht am Hindukusch, sondern vor allem im Mittelmeerraum und im Subsahararaum verteidigt.
Die Vorfeldsicherung gegenüber Islamismus und Terrorismus sowie die Prävention illegaler Migration erfordern entwicklungspolitische Erfolge, aber auch kontrollierbare Grenzen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten sind zusammen die größten Entwicklungshilfegeber der Welt. Für einen besseren Einsatz dieser Mittel müssten Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik in Zusammenhängen gedacht werden und sich zudem weniger an bloßen Wünschen und mehr an der Realität orientieren. Die immerzu geforderte ›Augenhöhe‹ in der Entwicklungszusammenarbeit setzt auf beiden Seiten realistische Einsichten und ein entwicklungsförderndes Verhalten voraus.
Gerade weil sich ein westliches Staats- und Gesellschaftsverständnis nicht ohne weiteres universalisieren lässt, muss der westliche Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit den einzelnen Bürger – und vor allem die einzelne Bürgerin – in den Blick nehmen und privatwirtschaftliche Initiativen stärken. Denn: Freie Gesellschaften benötigen freie, selbständige und dafür gebildete und ausgebildete Bürger.