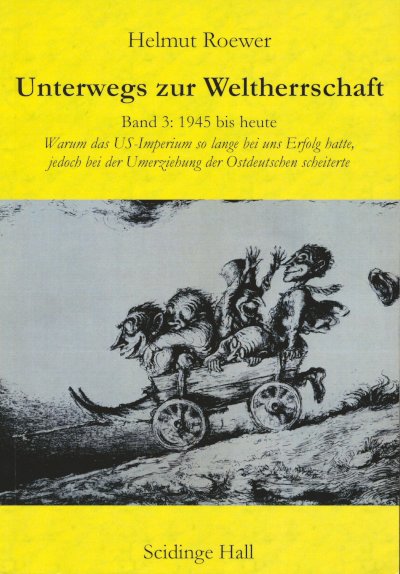von Ingo Schmidt
Die 1990er Jahre gelten weithin als ein Jahrzehnt neoliberaler Globalisierung. Nur die europäische Sozialdemokratie schien dem Strom entfesselter Weltmarktkonkurrenz zu widerstehen, den neoliberale und konservative Regierungen in allen anderen Teilen der Welt entfesselt hatten. Zunehmende Wählerunterstützung hatte 1998 in 13 der damals 15 EU-Mitgliedsstaaten Sozialdemokraten an die Regierung gebracht.
Diese waren eifrig damit beschäftigt, ein Europäisches Sozialmodell (ESM) zu entwickeln und als Alternative zum angelsächsischen Kapitalismus zu präsentieren. Nach dem EU-Gipfel in Maastricht 1992 wurde der 1986 bereits in Leben gerufene Soziale Dialog zu einem Konsultationsprozess zwischen Unternehmerverbänden, Gewerkschaften und EU-Kommission aufgewertet. Analog dazu wurde 1999 der Makroökonomische Dialog geschaffen. 2001 verkündete die EU den Lissabon-Prozess, demzufolge Europa innerhalb eines Jahrzehnts zur schnellstwachsenden und konkurrenzfähigsten Weltregion werden sollte. Von nun an wurde vom ESM nicht nur sozialer Zusammenhalt erwartet, sondern auch die Stimulierung wirtschaftlichen Wachstums. Zur Unterstützung dieses Zieles werden seit 2003 jährliche Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung abgehalten.
Allerdings erfüllten sich weder die Wachstumshoffnungen noch die Erwartungen bezüglich des sozialen Zusammenhalts. Das Wirtschaftswachstum in der EU konnte seit 2000 nicht zu dem der USA aufschließen und blieb zudem unter den Werten, die in den neunziger Jahren in beiden Regionen erzielt wurden. Nachdem zehn osteuropäische Länder 2004 in die EU aufgenommen wurden, kam der europäische Integrationsprozess infolge zweier Volksabstimmungen 2005 zum Stillstand, bei denen sich die niederländischen und französischen Wähler mehrheitlich gegen den EU-Verfassungsplan aussprachen. 2008 fiel auch die leicht veränderte Fassung dieses Plans, aus welcher der ambitionierte Titel Verfassung allerdings gestrichen war, bei einer Volksabstimmung in Irland durch. Damit waren nicht nur die Tage des ESM-Aufbaus gezählt, sondern auch das sozialdemokratische Comeback der neunziger Jahre beendet. Wie bereits 1998 waren Sozialdemokraten auch 2008 in 13 EU-Staaten an der Regierung beteiligt, allerdings hatte sich die Mitgliedszahl zwischenzeitlich von 15 auf 27 erhöht. In vielen Ländern erlebten sozialdemokratische Parteien herbe Wahlniederlagen und massive Mitgliederverluste.
In diesem Artikel soll eine Erklärung für den kurzen Moment des ESM sowie das sozialdemokratische Comeback in den 1990ern gesucht werden. Sozialdemokratische Vorstellungen eines ESM beruhen auf einem »Transponierungs- und Erweiterungs-Modell«, das Sozialstaaten, die sich in Westeuropa auf nationalstaatlicher Ebene entwickelt haben, auf die EU-Ebene transponieren soll. Gleichzeitig soll ein solchermaßen europäisierter Sozialstaat auf die neuen EU-Mitglieder Osteuropas ausgeweitet werden. Dieses Modell schreibt eine Reihe wirtschaftlicher und politischer Vorstellungen fort, die fest in die Geschichte der europäischen Sozialdemokratie eingeschrieben sind: Das Vertrauen auf Wirtschaftswachstum als Voraussetzung sozialer Gerechtigkeit, die Vernachlässigung des Verhältnisses von Zentren zu Peripherien sowie die zentrale Rolle des Staates für die Austragung und Beilegung sozialer Konflikte. Freilich wird keine dieser Vorstellungen der europäischen Wirklichkeit gerecht. Seit dem Ende des langen Nachkriegsaufschwungs sind die Wachstumsraten in Europa niedrig geblieben, spätestens seit der Osterweiterung 2004 lassen sich die Unterschiede zwischen Zentren und Peripherien nicht mehr leugnen und eine europäische Öffentlichkeit, die an die Stelle nationalstaatlicher Öffentlichkeiten treten könnte, besteht bestenfalls in ersten Ansätzen. Das Auseinanderklaffen zwischen den sozialdemokratischen Vorstellungen, auf deren Grundlage das ESM gebaut wurde, und der europäischen Wirklichkeit haben zu dem raschen Übergang vom Ausbau des ESM zur gegenwärtigen Krise der europäischen Integration in hohem Maße beigetragen. Dieses Argument wird in drei Schritten entfaltet: Zuerst wird ein Überblick über die wissenschaftlichen und politischen Diskussionen zum Thema ESM gegeben, dem eine kurze Geschichte des real existierenden ESM folgt. Zum Schluss wird auf die Erbschaft des europäischen Sozialismus eingegangen, sofern diese die Entwicklung des realen ESM bzw. die aktuelle Krise der europäischen Integration beeinflusst hat.
Diskussionen über das ESM
Wissenschaftliche und politische Diskussionen über das Europäische Sozialmodell drehen sich vorwiegend um den Aufbau von Institutionen. Sie behandeln ökonomische und soziale Bedingungen als externe Faktoren, denen sich die Institutionen anzupassen haben. Globalisierung ist der bekannteste und zugleich unbestimmteste unter diesen externen Faktoren. Der Globalisierungsthese zufolge unterminiert eine Zunahme grenzüberschreitender Handels- und Kapitalströme die Fähigkeit des Staates regulierend in den Wirtschaftsablauf einzugreifen. Allerdings könne die vollständige Unterwerfung der Politik unter den Sachzwang des Weltmarktes durch Anpassung nationalstaatlicher Institutionen sowie den begleitenden Aufbau supranationaler Institutionen vermieden werden. Diese sehr allgemeinen und wohl bekannten Argumente bilden den Rahmen für die Mehrzahl der Untersuchungen über europäische Sozialstaaten und Entwürfe eines ESM (Herrmann 2007, Hermann/Hofbauer 2007). Die meisten Studien vergleichen bestehende Sozialstaaten und versuchen sie auf unterschiedliche Weise zu klassifizieren. Besonders bekannt sind die Unterscheidungen zwischen liberalen, konservativen und sozialdemokratischen Welten des Wohlfahrtsstaates (Esping-Anderson 1990), zwischen liberalen und koordinierten Marktwirtschaften (Hall/Soskice 2001) oder Marktwirtschaft, gelenktem Kapitalismus und Staatskapitalismus (Schmidt 2002). Zusammen mit einigen anderen (Coates 2000, Ebbinghaus/Manow 2001, Streeck/Yamamura 2005) bilden diese Klassifizierungen Idealtypen, die einen gemeinsamen Referenzpunkt haben: Das US- oder angelsächsische Kapitalismusmodell. Letzteres, so unterstellt die vergleichende Sozialstaatsforschung, repräsentiere die Unterwerfung der Politik unter den Sachzwang der Märkte, während das Fortbestehen der europäischen Sozialstaaten als Beleg für die Möglichkeit institutioneller Vielfalt und politischer Wahlmöglichkeiten auch im Zeitalter der Globalisierung verstanden wird. Aus solchen Analysen lässt sich leicht die Gegenüberstellung eines »sozialen Europas« mit einem »liberalen Amerika« (Pontusson 2005) ableiten. Solche Dichotomien sind ebenso verbreitet wie falsch.
Immerhin ist zu bedenken, dass nicht nur die USA, sondern auch Australien, Neuseeland, Kanada und Britannien zum angelsächsischen Kapitalismus gehören. Letzteres ist gleichfalls Mitglied der EU und man darf daher annehmen, dass es auch Teil des ESM ist. Immerhin hat die New Labour-Regierung 1998 die Sozialcharta der EU unterzeichnet und deren Integration in die EU-Verträge ermöglicht. Wenn Britannien aber irgendwie doch zum ESM gehört, wird die Unterscheidung zwischen angelsächsischem Kapitalismus und ESM fragwürdig. Zudem unterschlägt die Zuordnung Britanniens zum liberalen Sozialstaatsmodell einen erheblichen Teil seiner Nachkriegsgeschichte, zu der außer dem Aufbau eines Sozialstaates à la Beveridge auch Verstaatlichungen großen Stils gehören. Fraglich ist schließlich auch, ob sich die unterschiedlichen Sozialstaaten Europas zu einem einheitlichen sozialen Europa zusammenfassen lassen. Während einige Wissenschaftler die Möglichkeit einer Transponierung nationalstaatlicher Sozialstaaten auf die EU-Ebene für die Zukunft ins Auge fassen (Bieler 2006, Erne 2008), gehen andere genau andersherum davon aus, dass die bestehende Vielfalt europäischer Sozialstaaten der Konvergenz zu einem ESM im Wege steht (Scharpf 2002). Demnach sehen ESM-Optimisten in der institutionellen Vielfalt europäischer Sozialstaaten einen formbaren Rohstoff, aus dem sich auf der EU-Ebene ein Sozialmodell bauen lässt, während Skeptiker diese Vielfalt eher als stählernen Rahmen ansehen, der nationalstaatliche Entwicklungspfade vorzeichnet, eine Transponierung nationalstaatlicher Vielfalt in eine stärker vereinheitlichtes EU-Modell jedoch ausschließt. Aus dieser Speisekarte verschiedener wissenschaftlicher Einschätzungen können Politiker und Lobbyisten nach ihrem jeweiligen Geschmack auswählen. EU-Offizielle und andere Akteure auf der EU-Ebene, beispielsweise der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) oder die Partei der europäischen Sozialisten, bevorzugen zumeist ein Menü, in dem das ESM als eine im Entstehen begriffene Realität angesehen wird. Von den pfadabhängigen Entwicklungen einzelner Sozialstaaten ebenso vorangetrieben wie von EU-Initiativen, scheint sich Europa entweder in Richtung eines vereinheitlichten Sozialmodells oder der Koexistenz lose koordinierter Sozialstaaten zu bewegen (Dimantopolou 2003, ETUC 2007).
Trotz unterschiedlicher Einschätzung der Entwicklungsmöglichkeiten des ESM ist diesen unterschiedlichen Diskussionssträngen eine institutionalistische Perspektive gemeinsam. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich von der neoklassischen Ökonomie, der zufolge der Abbau politischer Regulierungen sowie der dafür notwendigen Institutionen die einzig denkbare Form der Anpassung an die Globalisierung der Wirtschaft darstellt. Gegenüber diesem teleologischen Weltbild halten institutionalistische Analysen an der Auffassung fest, dass zwischen nationalstaatlichen oder auch supranationalen Anpassungsformen Wahlmöglichkeiten bestehen, über die politisch entschieden werden kann. Sie teilen mit der Neoklassik jedoch den Ausgangspunkt: Wirtschaftliche Globalisierung und hiervon ausgehende Anpassungszwänge des politischer Institutionen werden auch von institutionalistischen Theorien nicht in Frage gestellt. Dieser »methodische Ökonomismus« hat weitreichende Folgen für Gestaltung, Aufbau und Funktionsfähigkeit des ESM.
Während die neoklassische Ökonomie behauptet, dass unregulierte Märkte die einzige Möglichkeit sind, vorhandene Ressourcen vollständig auszunutzen und dadurch zugleich das Wirtschaftswachstum zu maximieren, geht der Sozialstaatsinstitutionalismus davon aus, dass er dieses Ziel durch politische Regulierungen erreichen kann, indem er die soziale Gerechtigkeit in eine Quelle ökonomischer Effizienz transformiert (Fajertag/Pochet 2000, Iversen 2000). Solche Überlegungen spielten bei der Institutionalisierung des Lissabon-Prozesses 2001 eine große Rolle. Dieser Prozess fördert die Ersetzung sozialstaatlicher Umverteilung durch eine Mobilisierung allen verfügbaren Humankapitals und sollte die EU dadurch zur schnellstwachsenden Region der Welt machen. Ironie der Geschichte: Im selben Jahr, in dem die EU ihre ambitionierten Ziele verkündete, ging der New Economy-Boom zu Ende. Der Börsenkrach 2001 sowie die anschließende Rezession machten schlagartig deutlich, dass Wirtschaftswachstum keinesfalls ein exogener Faktor ist, auf dessen Wirken man sich verlassen kann. Zudem wurde in der Krise deutlich, dass sich die politischen Handlungsmöglichkeiten der EU durch die neoliberalen Regeln des Binnenmarktprogramms sowie der Währungsunion selbst politische Fesseln angelegt hatten. Eine Politik des knappen Geldes und das Bemühen, die Defizitregeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzuhalten, hatten einen pro-zyklischen Effekt, weshalb die Rezession in Europa im letzten Jahrzehnt wesentlich länger anhielt als in den USA und anderen Regionen der Welt.
Diese kursorischen Hinweise mögen genügen, um zu zeigen, dass die EU weit davon entfernt ist, einen alternativen Anpassungspfad in Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung zu beschreiten. Sie ist vielmehr selbst eine politisch treibende Kraft neoliberaler Globalisierung (Van Apeldoorn 2000). Der Sozialstaatsinstitutionalismus, der die unterschiedlichen Entwürfe zum ESM entwickelt, ignoriert die sozialen Kräfte vollständig, die die EU zu einer treibenden Kraft von Neoliberalismus und Globalisierung gemacht haben. Daher hat er auch kein Verständnis für die sozialen Interessen, die dem ESM entweder aktiv entgegenarbeiten oder es in einer Weise auszugestalten trachten, die mit ihren eigenen neoliberalen Zielsetzungen vereinbar ist.
Eng verbunden mit den Fragen wirtschaftlichen Wachstums und Integration, und ebenso vom Sozialstaatsinstitutionalismus vernachlässigt, sind der Wandel des Verhältnisses von Zentren zu Peripherien und regionale Ungleichheiten. Der neoliberale Umbau der EU (Hermann 2007), der in den 1980er Jahren mit dem Binnenmarktprogramm begonnen hat, ging mit einer Vertiefung regionaler Ungleichheit einher (Amendola et al. 2004). Darüber hinaus, so argumentieren einige Forscher (Bohle/Greskovits 2004), hat die erste Runde der EU-Osterweiterung zur Herausbildung von Zentrum-Peripherie-Beziehungen zwischen West- und Osteuropa geführt. Dadurch werden den osteuropäischen Ländern Ressourcen entzogen, die andernfalls zur Entwicklung eines Sozialstaatskapitalismus zur Verfügung stehen würden, so aber zur Befestigung peripherer Abhängigkeit führen. Daher überrascht es auch nicht, dass die in Osteuropa bestehenden sozialstaatlichen Institutionen nur rudimentäre Absicherungen erlauben (Cerami 2005). Insofern ähnelt Osteuropa dem angelsächsischen Kapitalismus, der von Anhängern des Sozialstaatsinstitutionalismus dem ESM als Negativbeispiel gegenübergestellt wird.
Zugegebenermaßen ließen sich konzeptionelle Inkonsistenzen des ESM, seiner Durchsetzung entgegenwirkende soziale Kräfte sowie die Spaltungen zwischen Zentren und Peripherien eine Zeit lang vernachlässigen. Wähler, die von den gebrochenen Versprechungen neoliberaler Parteien die Nase voll hatten, stimmten in zunehmendem Maße für sozialdemokratische Parteien, die in unterschiedlicher Form ein soziales Europa versprachen. Die verbreitete Nachfrage nach Alternativen zum Neoliberalismus erklärt, weshalb die Sozialdemokratie in den späten 1990er Jahren über die politischen Mehrheiten verfügte, die sie zur Beschleunigung des ESM-Aufbaus benötigten. Allerdings kann mit Hilfe der genannten Faktoren erklärt werden, weshalb die Möglichkeit für diesen Aufbau nur kurze Zeit bestand und die in dieser Zeit geschaffenen Institutionen weder soziale Sicherheit in nennenswertem Maße produzieren noch zur Legitimation des europäischen Integrationsprozesses beitragen. Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, soll allerdings der kurze Augenblick des ESM-Aufbaus selbst betrachtet werden.
Die Entstehung des real existierenden ESM
Die institutionelle Geschichte des ESM geht auf die Römischen Verträge zurück, von denen die Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union ihren Ausgangspunkt nahmen. Diese Verträge beinhalteten auch das Europäische Wirtschafts- und Sozialkomitee, das Unternehmensvertretern und Gewerkschaftern als Forum gemeinsamer Diskussionen diente. Allerdings war die Prosperitätsphase jener Zeit vornehmlich vom Aufbau nationaler Sozialstaaten begleitet. Klassenkompromisse wurden auf nationalstaatlicher Ebene ausgehandelt, so dass für das Wirtschafts- und Sozialkomitee wenig zu tun blieb. Erst 1997, als Teil des ESM-Aufbaus jener Jahre, wurde dieses alte Komitee von einem freiwilligen Diskussionsforum der sogenannten Sozialpartner zu einem Gremium aufgewertet, dass der Europäische Rat, das Parlament sowie die Kommission bei allen Entscheidungen konsultieren müssen, die Wirtschaft und Soziales betreffen (EESC 2007). Der ESM-Aufbau insgesamt wurde Mitte der achtziger Jahre als Komplement zum Binnenmarktprojekt in Angriff genommen. Die Gemeinsame Europäische Akte von 1986, die den Übergang von der Europäischen Zollunion zu einem Gemeinsamen Markt vorsah, beinhaltete mit dem Sozialen Dialog ein weiteres Forum, das korporatistische Verhandlungen zwischen Sozialpartnern und EU-Institutionen vorsah. Für diese Ergänzung zum Europäischen Wirtschafts- und Sozialkomitee machte sich der damalige Präsident der EU-Kommission Jacques Delors stark. Hinter der komplementären Entwicklung von Binnenmarkt und Sozialem Dialog standen drei Überlegungen: Um gegenüber den USA und Japan konkurrenzfähig zu bleiben, bedürfe es eines vergrößerten Binnenmarktes, der europäischen Firmen eine Vertiefung ihrer Arbeitsteilung sowie die Realisierung von Skaleneffekten erlauben würde, für welche nationale Märkte zu klein waren. Um, zweitens, die Gewerkschaften in das Binnenmarktprojekt sowie die damit anstehenden Restrukturierungsprozesse der Industrie einzubinden, sollte eine Art korporatistischer Mitsprachemöglichkeit geschaffen werden. Letztere sollte auf EU-Ebene erfolgen, da entsprechende Regulierungskapazitäten auf nationalstaatlicher Ebene durch zunehmende, und durch den Binnenmarkt weiter beförderte, Kapitalmobilität immer mehr unterlaufen würden (Scharpf 1991). Eine ähnliche Form sozialer Integration wurde auch im Falle der Europäischen Währungsunion angestrebt, die mit dem Vertrag von Maastricht 1992 begann. Zu diesem Zweck wurde die Sozialcharta, die vom Europäischen Rat 1989 verabschiedet wurde, in die EU-Verträge aufgenommen (EU 2005) – allerdings lediglich als Anhang und nicht als rechtswirksames eigenes Kapitel der Verträge. Eine so weitgehende Aufwertung der Sozialcharta wurde von der konservativen Regierung Britanniens damals blockiert.
Seinen Höhepunkt erreichte der ESM-Aufbau Ende der neunziger Jahre, als 13 der damals 15 EU-Mitgliedsstaaten von Sozialdemokraten regiert wurden. Der EU-Gipfel in Amsterdam 1997 initiierte die Europäische Beschäftigungsstrategie, deren Nationale Aktionspläne als Komplement zu den fiskalpolitischen Leitlinien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes gedacht waren und das Beschäftigungswachstum innerhalb der Mitgliedsländer fördern sollten (EU 1997, EU 2007). Hierdurch wurde das Wirtschafts- und Sozialkomitee enger als jemals zuvor in die europäischen Entscheidungsprozesse eingebunden. Der Kölner EU-Gipfel 1999 setzte den Makroökonomischen Dialog zwischen Europäischer Zentralbank, EU-Kommission, sowie Regierungen und Sozialpartnern der Mitgliedsländer in Gang (Koll 2005). Der Lissabon-Gipfel 2000 stellt einen Wendepunkt im ESM-Aufbau dar. Statt weitere Institutionen auf der EU-Ebene zu schaffen, wurde die Methode der Offenen Koordinierung eingeführt, bei der sich die Regierungen der Mitgliedsstaaten gegenseitig auf Ziele und Methoden des Integrationsprozesses abstimmen sollen. Das ambitionierte Ziel, korporatistische Institutionen und Aushandlungsprozesse von der nationalstaatlichen auf die EU-Ebene zu „verschieben“, wurde zu Gunsten zwischenstaatlicher Verhandlungen aufgegeben. Bei letzteren haben die Regierungen der Mitgliedsländer sowie der Europäische Rat das letzte Wort, während der Einfluss der Institutionen auf EU-Ebene beschränkt bleibt. Zudem wurde das ESM samt der nationalen Sozialstaaten dem wirtschaftlichen Ziel unterworfen, die EU innerhalb von zehn Jahren zur wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu machen. Erhöhte Beschäftigungsquoten, Humankapitalbildung und die Gründung neuer Unternehmen sollten diesem Ziel dienen. Darüber hinaus sollte die Aufbringung von Risikokapital unterstützt und durch eine Politik strikter Inflationsbekämpfung (ECB 2003) flankiert werden. Mit der Annahme der sogenannten Lissabon-Strategie wurde die Phase des ESM-Aufbaus sowie die damit verbundene »Doppelherrschaft« keynesianisch-korporatistischer und neoliberaler Strategien der europäischen Integration beendet (Allen 2000, Aust 2000).
Zweifellos lässt sich eine Kontinuität neoliberaler Politikvorstellungen vom Binnenmarktprogramm über die Währungsunion bis zur Lissabon-Strategie feststellen. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass Unzufriedenheit und Ablehnung des Neoliberalismus seit Mitte der neunziger Jahre weltweit zugenommen haben. Der europäische Beitrag zu dieser Entwicklung bestand in einer ganzen Reihe von Protesten, die Gewerkschaften und andere soziale Bewegungen anlässlich der turnusmäßigen EU-Gipfel organisiert haben und bei denen sie ein Soziales Europa propagierten. Zur gleichen Zeit gewannen Europas Sozialdemokraten eine Reihe nationaler Wahlen, in deren Vorfeld sie für eine Alternative zum Neoliberalismus ihrer konservativen Vorgängerregierungen geworben hatten (Schmidt 2008).
Mit Blick auf die weit verbreitete Ablehnung des Neoliberalismus sowie den seit Beginn des Binnenmarktprogramms erreichten Stand der europäischen Integration war die Idee durchaus naheliegend, nationalstaatliche Sozialmodelle auf die EU-Ebene zu transponieren. In diesem Transponierungsmodell sollten die ESM-Institutionen als Gegenkräfte zum Neoliberalismus von Binnenmarktprogramm und Währungsunion dienen, in ähnlicher Weise, in der nationalstaatliche Sozialmodelle in der Vergangenheit dem ungebremsten Profitstreben entgegengewirkt hatten. Diese Zielsetzung implizierte auch, dass die nationalen Klassenkompromisse, die in der Vergangenheit die soziale Basis nationaler Sozialstaaten gewesen waren und durch neoliberale Kapitalfraktionen seit den späten 1970er Jahren aufgekündigt worden waren, auf der europäischen Ebene neu begründet werden müssten. In einer Zeit sozialdemokratischer Wahlerfolge, zunehmender Ablehnung des Neoliberalismus und gewerkschaftlicher Mobilisierungen für ein soziales Europa war ja die Annahme, neoliberalen Wirtschaftsführern ließe sich ein europäischer Klassenkompromiss abringen, auch nicht ganz abwegig. Es ist aber nicht dazu gekommen. Wie sich herausstellte, ließ sich das europäische Unternehmertum nicht zu einem korporatistischen Arrangement mit den Gewerkschaften überreden. Es gibt wirtschaftliche und politische Gründe, weshalb der Versuch, nationalstaatliche Korporatismen auf die EU-Ebene zu transponieren, fehlgeschlagen ist.
Ein erfolgreicher Korporatismus setzt eine Öffentlichkeit voraus, in der gegensätzliche Interessen ausgehandelt und in Kompromisse übersetzt werden können. Wie bereits erwähnt, waren Gewerkschaften und sozialdemokratische Parteien in ihren jeweils nationalen Öffentlichkeiten schon seit den siebziger Jahren in der Defensive. Zur gleichen Zeit begannen die Unternehmensspitzen verschiedener Länder mit dem Aufbau europäischer Netzwerke, von denen der European Roundtable of Industrialists (Van Apeldoorn 2000) das bekannteste ist. Diese Netzwerke waren entscheidend für die Durchsetzung des Neoliberalismus in der EU und sind es noch immer (Balanyá u.a. 2000). Trotz der Existenz des Europäischen Gewerkschaftsbundes und gelegentlicher Demonstrationen auf EU-Ebene hat sich bislang keine europäische Öffentlichkeit herausgebildet, in der sich die Repräsentanten von Arbeit und Kapital gegenseitig anerkennen und zur Aushandlung von Kompromissen bereit bzw. in der Lage sind. Das europäische Unternehmertum sammelte sich trotz unterschiedlicher Interessen von Finanz-, Industrie- und Kaufmannskapital sowie zwischen Groß- und Kleinunternehmen und international agierenden bzw. auf nationale Märkte ausgerichteten Firmen unter dem Banner des Neoliberalismus. Dagegen sind die europäischen Arbeiterklassen zunehmend fragmentiert. Gewerkschaften haben, mit zum Teil erheblichen Unterschieden von Land zu Land, Mitglieder im verarbeitenden Gewerbe verloren und hatten große Probleme, die Beschäftigten in neu entstehenden bzw. expandierenden Sektoren zu organisieren (Mückenberger u.a. 1996, Stützel 1994). Der gewerkschaftliche Organisationsgrad war rückläufig und die Zusammensetzung der Mitgliedschaft entsprach immer weniger jener der gesamten Erwerbstätigen. Angesichts einer schleichenden Krise der Repräsentation sowie dem damit einher gehenden Verlust an Verhandlungsmacht, sahen sich die europäischen Gewerkschaften vor die Wahl gestellt, entweder ihre gesamten Ressourcen zur Verteidigung nationaler Sozialstaaten oder zur Europäisierung ihrer Organisationen aufzuwenden (Bieler 2006). Selbst innerhalb der Sozialdemokratie, immerhin die treibende Kraft hinter dem ESM, wurden Zweifel an den Erfolgsaussichten der Europäisierungsstrategie angemeldet. Dies gilt insbesondere für die kleineren EU-Länder, deren Bevölkerungen und Organisationen die europäische Integration vielfach als Instrument der Machtdurchsetzung der großen Mitgliedsstaaten ansehen. Insbesondere in Skandinavien, dessen Sozialstaaten einen erheblich besseren Schutz bieten als es von einem ESM auf absehbare Zeit erwartet werden kann, wurde die Europäisierung von Gewerkschaften und Sozialstaat argwöhnisch betrachtet. Zusätzlich erschwert wurde eine mögliche Europäisierung durch die Frage, ob das ESM keynesianisch oder eher dem Dritte Weg-Modell der post-keynesianischen Sozialdemokratie entsprechen sollte (Notermans 2000, Kap. 6). Auch die Parteien links der Sozialdemokratie waren in der Frage Europäisierung oder Verteidigung nationaler Sozialstaaten gespalten. Im Gegensatz zur Dritte Weg-Sozialdemokratie haben sie zwar keine Anpassung an den, sondern Alternativen zum Neoliberalismus propagiert, waren aber bislang nicht fähig, hierzu eine stimmige Strategie zu formulieren, die insbesondere die gegenwärtige Schwäche der Arbeiterklasse überwinden helfen könnte (Neubert 2001, Wehr 2001).
Strategische Unstimmigkeiten haben die europäische Sozialdemokratie, andere linke Parteien und Gewerkschaften zu wenig effektiven Akteuren auf der nationalstaatlichen und der EU-Ebene gemacht. Auf der anderen Seite des Klassengegensatzes haben die Kräfte des Kapitals eine sehr wirkungsvolle Zwei-Ebenen-Strategie (Putnam 1988) verfolgt, indem sie neoliberale Politikkonzepte in die Institutionen der EU eingeschrieben haben und deren Umsetzung – unter Berücksichtigung der sozialen Kräfteverhältnissen in einzelnen Ländern – den Regierungen der Mitgliedsstaaten überlassen (Scharpf 2001). Mit dieser Strategie waren sie so erfolgreich, dass sie sozialdemokratische Regierungen via des Dritten Weges auf neoliberale Pfade locken konnten. Dabei unterschied sich der Dritte Weg vom Neoliberalismus lediglich durch die Bereitschaft, korporatistische Mittel für neoliberale Zwecke einzusetzen. Als zweitrangige Akteure in der neoliberalen Zwei-Ebenen-Strategie verlor die Sozialdemokratie Ansehen und Wähler unter Arbeitern, Arbeitslosen und Rentnern, die sich von sozialdemokratischen Regierungen entweder eine Stärkung nationaler Sozialstaaten oder die Schaffung anderer sozialer Schutzmechanismen zur Abwehr der neoliberalen Offensive erhofft hatten. Mit dem Einschlagen des Dritten Weges wurden solche Hoffnungen enttäuscht, so dass die sozialdemokratischen Regierungen alsbald abgewählt wurden. Allerdings haben es weder die Parteien links der Sozialdemokratie noch Gewerkschaften oder andere soziale Bewegungen geschafft, die Ablehnung des Neoliberalismus sowie die Enttäuschung über die Dritte Weg-Sozialdemokratie in eine Bewegung für politische Alternativen umzuwandeln.
Zwei ökonomische Entwicklungen haben diese Schwäche der europäischen Arbeiterbewegung besonders deutlich werden lassen. Eine davon war die Osterweiterung der EU, die andere der New Economy-Boom. Beim Europäischen Ratstreffen in Kopenhagen 1993 wurden drei Bedingungen festgelegt, unter denen die Länder Osteuropas der EU beitreten könnten: die Existenz einer repräsentativen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eine funktionsfähige Marktwirtschaft. Mit der Vorbereitung der Osterweiterung verbreiteten sich im Westen Ängste vor einem Unterbietungswettbewerb, der westliche Löhne und Sozialstandards auf das Niveau Osteuropas herunterdrücken würde. Gleichzeitig fürchteten viele Menschen im Osten die Dominanz von EU-Bürokratie und westlichen Konzernen. Mit der EU-Osterweiterung wurden die Beziehungen zwischen Zentren und Peripherien ein nicht mehr zu verdrängender Bestandteil der europäischen Integration. Hierauf war die Sozialdemokratie schlecht vorbereitet, weil sie internationale Machtgefälle in ihren Strategiedebatten zumeist vernachlässigt oder als ein zu vernachlässigendes Problem weit entfernter Länder angesehen hat. Seit dem Zusammenbruch des Staatssozialismus in Osteuropa sowie der Perspektive der Osterweiterung drängte das Thema Zentrum und Peripherie sowie die damit verbundenen Ängste vor einer Unterbietungskonkurrenz immer mehr auf die europäische Tagesordnung. Dagegen kam das Ende der New Economy, an die sich so viele Hoffnungen der Dritte Weg-Sozialdemokratie geknüpft hatte, als ein unerwarteter Schock. Danach stellte sich sehr schnell heraus, dass die Lissabon-Strategie auf den gleichen unsicheren Grundlagen wie der Clinton-Boom der 1990er Jahre ruhte und dass das Wachstum in Europa weitgehend von Exporten in die USA abhängig war. Nachdem die Nachfrage-Stimulierung aus dem Westen wegfiel und aus dem Osten der kalte Wind zunehmender Konkurrenz blies, stellte sich die Frage nach den wirtschaftlichen Grundlagen des ESM. Ist grenzenloses Wachstum möglich? Kann auf dieser Grundlage sozialer Ausgleich geschaffen werden, selbst wenn einige Länder von diesem Wachstumsprozess ausgeschlossen sind? Die Sozialdemokratie konnte diese Fragen nicht beantworten. Von sonstigen Strategiewechseln abgesehen, ist die Geschichte der Sozialdemokratie von einer Kontinuität ihres ökonomischen Denkens durchzogen, die auch die sozialdemokratische Konzeption des ESM beeinflusst hat. Es ist sicherlich richtig, dass die Übernahme und Propagierung bestimmter ökonomischer Ideen wahlentscheidend sein kann (Hall 1989), es stimmt aber auch, dass das Festhalten an bestimmten Ideen unter gewandelten Umständen zum Verlust von Wählerstimmen und Regierungsämtern führen kann. Die Vorstellung, ein ESM auf der Grundlage unbegrenzten Wachstums und unter Vernachlässigung der Beziehungen zwischen Zentren und Peripherien aufbauen zu können, gehört in diese letztgenannte Kategorie.
Wirkungsmächtige Geschichte: Europäischer Sozialismus und das real existierende ESM
Das Grundthema sozialdemokratischer Wirtschaftstheorie, das seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in unterschiedlichen Variationen gespielt wurde, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Technischer Fortschritt ist die unabhängige Variable, die das Wirtschaftswachstum antreibt und damit die Voraussetzungen sozialen Ausgleichs schafft. Umgekehrt kann das Wachstum durch politische Konflikte, die einen solchen Ausgleich verhindern, blockiert werden. Glücklicherweise steht mit dem Staat eine neutrale Instanz zur Verfügung, die zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln und damit günstige Bedingungen für technischen Fortschritt und Wachstum schaffen kann. Die staatlichen Kapazitäten zur Konfliktregulierung hängen entscheidend von der Fähigkeit zur Schaffung eines klassenübergreifenden Konsenses, eines nationalen Interesses, ab.
Die internationale Arbeitsteilung sowie die Stellung eines Staates im internationalen Staatensystem bleiben in dieser Theorie weitgehend unbeachtet oder werden später als externer Faktor zugefügt. Diese auf einzelne Staaten zentrierte Sichtweise impliziert ferner, dass arme Länder, sofern sie angemessene Institutionen ausbilden können, durch einen Prozess nachholenden Wachstums zu den reichen Ländern aufschließen können. Wachstumsblockaden, denen periphere Länder als Folge ihrer Unterordnung unter die kapitalistischen Zentren unterliegen, werden entweder ausgeblendet oder mitunter sogar als ein notwendiges Durchgangsstadium zur Entwicklung rückständiger Länder angesehen (Mandelbaum 1974). Aufgrund der prominenten Rolle des technischen Fortschritts kann die sozialdemokratische Wirtschaftstheorie ›produktivistisch‹ genannt werden. Der Versuch, den Staat als neutralen Vermittler unterschiedlicher Interessen anzurufen, macht sie ›korporatistisch‹ und die Vernachlässigung der Hierarchien zwischen Zentren und Peripherien verleiht ihr einen ›euro-zentrischen‹ Charakter. Mit Blick auf die Ungleichheiten innerhalb Europas sollte man vielleicht besser von ‚Westeuropäischem Zentrismus’ sprechen. Seinen historischen Ursprung hat diese Haltung in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs und politischer Stabilität, welche die Revolutionsperiode, die 1789 mit dem Sturm auf die Bastille begann und mit der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 endete, sowie die von 1873 bis 1895 andauernde Depression folgte. Angesichts dieser Wendung von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen zu anhaltender Stabilität schien es naheliegend, den auf der Marxschen Krisentheorie begründeten Klassenkampf durch eine Politik der Klassenversöhnung zu ersetzen. Die Kooperation von Facharbeitern, Angestellten und Ingenieuren im Produktionsprozess wurde als soziologischer Kern einer entsprechenden Politik und gleichzeitig als Ausgangspunkt industrieller Demokratie angesehen. Auf dieser Grundlage sollte sich der Volksstaat (Bernstein 1922) entfalten, in dem die Interessengegensätze von Bourgeoisie und Proletariat aufgehoben seien. Die deutsche Sozialdemokratie ist für ihren Revisionismus bekannt (Bernstein 1899), allerdings verbreiteten sich die entsprechenden Ideen auch in anderen westeuropäischen Ländern (Berman 2006, Gustafsson 1972). Die Vorstellung, ein ESM ließe sich auf Basis einer von Wissensarbeitern geschaffenen Neuen Ökonomie erbauen, kann als Update des Revisionismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts verstanden werden. Die Analogie geht noch weiter. In beiden Zeitabschnitten wurden die Vorbilder für technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in Westeuropa entwickelt und osteuropäische Sozialdemokraten übernahmen die westlichen Modelle als Leitbilder ihrer Politik anstatt eigene, den spezifischen Bedingungen Osteuropas angepasste Strategien zu entwickeln.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine weitere Form des produktivistischen Korporatismus, die Idee des Organisierten Kapitalismus (Hilferding 1927). In der ersten Hälfte des Jahrhunderts schienen Kriege, Revolutionen und Wirtschaftskrisen der Vorstellung des Interessenausgleichs zwischen Klassen und Staaten noch zu widersprechen. Allerdings konnten die politischen und ökonomischen Katastrophen von 1914 bis 1945 durchaus mit der Abwesenheit von Gegenmächten erklärt werden, die solch einen Interessenausgleich ermöglicht hätte. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien die sozialdemokratische Vision von Prosperität und sozialer Gerechtigkeit, beide das Resultat politischen Interessenausgleichs, Wirklichkeit zu werden. Der keynesianische Sozialstaat verfügte über ausreichende Steuerungskapazitäten, um die vollständige Nutzung aller verfügbaren ökonomischen Ressourcen zu gewährleisten. Zwar erkannten viele sozialdemokratische Intellektuelle die Existenz von Klassen und Interessengegensätzen weiterhin an, sprachen ihnen jedoch keine die wirtschaftliche und soziale Entwicklung prägende Kraft mehr zu. Stattdessen setzten sie darauf, dass eine immerwährende Prosperität stets den notwendigen Verteilungsspielraum für korporatistische Verhandlungen zwischen Arbeit und Kapital schaffen würde (Galbraith 1952).
Es sollte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass die Traditionen der europäischen Sozialdemokratie nach dem Zweiten Weltkrieg sich mit der von Großbritannien und den USA ausgehenden keynesianischen Revolution verbanden (Hall 1989). Die Erste Welt präsentierte ihr Prosperitätsmodell als Vorbild für den angeblich weniger entwickelten Rest der Welt, in dem sich tatsächlich viele Nacheiferer westlicher Entwicklungsvorstellungen fanden. Dies gilt sogar für die Zweite Welt, die Sowjetunion und ihre osteuropäischen Verbündeten. Obwohl sich die Bolschewiki, die den Aufbau der Sowjetunion bestimmten, zu Beginn des 20. Jahrhunderts im politischen Streit von der europäischen Sozialdemokratie getrennt hatten, teilten sie mit dieser die Faszination amerikanischer Produktionsmethoden. Der Revolutionär Lenin pries Frederick Taylors wissenschaftliches Management ebenso wie reformistische Gewerkschaftsführer aus Deutschland oder der Austro-Marxist Otto Bauer (Lenin 1914 & 1918, ADGB 1926, Bauer 1931). In den dreißiger Jahren wurde Henry Fords River Rouge-Komplex zum Vorbild für industrielle Großprojekte wie Magnitogorsk (Dunn 1995, Kap.1). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Tayloristisch-Fordistische Produktionsmodell, selbstverständlich mit länderspezifischen Nuancen, in Osteuropa eingeführt und mit einer politischen Strategie verbunden, die konzeptionell an die Volksfront-Strategie der dreißiger Jahre (Dimitroff 1935) anknüpfte und für sich beanspruchte, Klassengegensätze in einer Volksdemokratie aufzuheben.
Die Parallelen zwischen osteuropäischem Sowjetmarxismus (Marcuse 1964) und westeuropäischer Sozialdemokratie sind unübersehbar. Der entscheidende Unterschied bestand darin, dass letztere von einem Konzept schrittweiser sozialistischer Transformation ausging und bei der sozialstaatlichen Umgestaltung des Kapitalismus landete, während letzterer die Ausdehnung des Sowjetsystems in die Länder Osteuropas rechtfertigen sollte. Trotzdem kamen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs nahezu identische technologische Prinzipien zur Anwendung. Vom gleichen Verständnis wissenschaftlicher Rationalität ausgehend, verkündete der Osten den Aufbau klassenloser Gesellschaften, real existierender Sozialismus genannt, während im Westen die Irrelevanz des Klassenkampfes im Sozialstaatskapitalismus verkündet wurde. Der Staat wurde in Ost und West gleichermaßen als Garant wirtschaftlichen Wachstums angesehen.
Wenig verwunderlich daher, dass der Ost-West-Konflikt mit einem Wettstreit um möglichst hohe Wachstumsraten einherging. Letzterer wurde Mitte der fünfziger Jahre durch Nikita Chrustschows Ankündigung berühmt, die Sowjetunion werde in wenigen Jahren das Produktivitätsniveau der USA einholen und überholen. Ostdeutschlands Walter Ulbricht verkündete das noch viel ambitioniertere Ziel, westliche Produktivitätsstandards zu überholen ohne sie vorher einzuholen. Obwohl dieses Ziel recht seltsam klingt, und auch von den meisten seiner Zeitgenossen einschließlich der eigenen Parteigenossen so wahrgenommen wurde, enthält es eine beachtenswerte Idee. Schließlich entwickelten einige Zirkel der osteuropäischen Nomenklatura in den sechziger Jahren die Idee der wissenschaftlich-technischen Revolution (Laitko 1996). Demnach würde die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis im Produktionsprozess höhere Wachstumsraten erlauben als Investitionen in zusätzliche Maschinen oder Arbeitskraft. Ähnliche Vorstellungen wurden zwar auch im Westen entwickelt (Habermas 1968) aber es dauerte noch bis in die achtziger Jahre, bis die Sozialdemokratie sich die Idee einer post-industriellen Gesellschaft, die auf der umfassenden Anwendung wissenschaftlicher Kenntnis im Produktionsprozess beruhen sollte, zu eigen machte. Entsprechende Vorstellungen gipfelten in den neunziger Jahren im Konzept der Wissensökonomie, die als ökonomische Basis des ESM angesehen wurde. In dieser Neuen Ökonomie wurden die Facharbeiter obsolet, die in der Vergangenheit als Kooperationspartner von Ingenieuren und Managern im Produktionsprozess sowie darüber hinaus als Rekrutierungsfeld für Partei und Gewerkschaften angesehen wurden. Ihre Stelle sollte von autonomen Individuen, sogenannten Wissensarbeitern, übernommen werden, deren Kreativität zu einer Ressource wirtschaftlichen Wachstums werden sollte, und die als selbständige Individuen keiner Vertretung durch Massenorganisationen mehr bedürften.
Der Wissensarbeiter ist die neueste Inkarnation einer sozialdemokratischen Tradition, die technischen Fortschritt als Quelle von Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt ansieht. Die zweite Tradition der Sozialdemokratie, das Vertrauen auf staatliche Steuerungskapazitäten, wurde allerdings gerade zu der Zeit in Frage gestellt, als die Wissensarbeiter die historische Bühne betraten. Ein Argument, das gegen staatliche Steuerung ins Feld geführt wurde, besagte, dass der Übergang von der Industriegesellschaft samt der ihr eigenen Klassengegensätze in die Wissensökonomie entwickelter Individuen den Staat als neutrale Vermittlungsinstanz überflüssig mache (Reich 1991). Mit anderen Worten: Durch den Aufstieg des Humankapitals zur entscheidenden Produktivkraft wurde der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital überwunden. Folglich würden auch die organisierte Arbeiterbewegung und ihr Gegenüber, die großen Konzerne, an Bedeutung verlieren (Lash/Urry 1987). Ein anderes Argument gegen fortdauernde Staatsintervention wies auf zunehmende Kapitalmobilität hin, mit der Steuern und Sozialstandards, ohne die ein Sozialstaat nicht denkbar ist, umgangen werden könnten (Scharpf 1991). Wissensökonomie und die Auswirkungen zunehmender Kapitalmobilität wurden von sozialdemokratischen Intellektuellen heiß diskutiert. Einige sahen sie eher als Bestandteil des neoliberalen Diskurses denn als empirische Realität (Hirst/Thompson 1999). Wenn das stimmt, könnten Keynesianismus und Sozialstaat, den entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt, gerettet werden. Allein: Sozialdemokratischen Regierungen fehlte der Wille.
In den achtziger Jahren hat die Sozialdemokratie die Kohärenz und Attraktivität verloren, die sie in der Nachkriegszeit zur treibenden Kraft des Sozialstaatsaufbaus gemacht hatte. Das ESM kann als Kompromiss zwischen den politischen Strömungen verstanden werden, die sich in der Sozialdemokratie nach der Hegemonie des keynesianischen Sozialstaates herausgebildet hatten. Einerseits hielt das ESM die Möglichkeit keynesianischer Politik, nunmehr auf EU-Ebene, offen. Andererseits erkannte es mit der Übertragung von Steuerungskapazitäten vom Nationalstaat auf die transnationale Ebene die Wirkungslosigkeit nationalstaatlicher Interventionen in Zeiten zunehmender Kapitalmobilität an. Die ökonomische Basis des ESM, dies zeigt die Lissabon-Strategie deutlich, wurde freilich in der Wissensökonomie gesucht. Sobald der New Economy-Boom der neunziger Jahre endete, stellte sich heraus, dass den korporatistischen Institutionen des ESM der wirtschaftliche Spielraum für einen erfolgreichen Interessenausgleich fehlte.
Das Transponierungsmodell des ESM scheiterte also, weil die Prosperität, die dem nationalstaatlichen Korporatismus in der Nachkriegszeit als ökonomische Basis gedient hatte, von der Wissensökonomie nicht gewährleistet werden konnte. Mit Blick auf Osteuropa, wo die soziale Ungleichheit seit Beginn der Restauration des Kapitalismus in den frühen 1990er Jahren zugenommen hatte, wird das Scheitern des ESM noch deutlicher. Kurze Zeit nach Beginn dieses Restaurationsprozesses hatten sozialdemokratische Parteien, die zumeist aus den früheren kommunistischen Staatsparteien hervorgegangen waren, eine Reihe unerwarteter Wahlerfolge, die zeitlich mit den Erfolgen ihrer westeuropäischen Genossen zusammenfielen bzw. diesen sogar etwas vorausgingen (Sassoon 1997). Allerdings konnten weder sozialdemokratische Regierungen noch EU-Beitritt samt der damit verbundenen Übernahme des ESM die Zunahme der Ungleichheit in den neuen europäischen Peripherien verhindern. In der Folge gewannen nationalistische und antidemokratische Bewegungen in vielen osteuropäischen Ländern an Einfluss (Becker 2006, Greskovits 2007).
Geringes Wachstum, das sich in Osteuropa aufgrund vertiefender Ungleichheiten zwischen Zentren und Peripherien besonders stark auswirkte, nahm dem ESM die ökonomischen Grundlagen, die für eine korporatistische Konfliktverarbeitung notwendig sind. Allerdings ist nicht ganz klar, ob die Transponierung und Ausweitung nationaler Sozialstaaten auf die EU-Ebene nur aus ökonomischen Gründen gescheitert ist. Wie bereits erwähnt, fehlen der Realisierung des entsprechenden ESM sowohl eine Europäische Öffentlichkeit als auch eine kohärente sozialdemokratische Strategie. Befürworter einer keynesianischen ESM-Version können gegenüber der tatsächlich existierenden Lissabon-Version behaupten, dass eine eurokeynesianische Politik zu höherem Wachstum und entsprechend erweiterten Umverteilungsspielräumen hätte führen können (Euromemorandum Group 2001 & 2007). Dieses Argument wirft allerdings die weitergehende Frage auf, in welchem Maße ökonomische Bedingungen politische Wahlmöglichkeiten bestimmen, bzw. in welchem Maße umgekehrt politische Interventionen die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen können. Eine der verschwiegenen Traditionen der Sozialdemokratie vom Bernsteinschen Revisionismus über den Sozialstaatskapitalismus bis zu ESM und Wissensökonomie besteht gerade darin, dass der politischen Intervention beständig das Wort geredet wurde und ökonomische Sachzwänge jedes Mal als Entschuldigung angeführt wurden, wenn die Intervention nicht stattfand oder nicht die gewünschten Resultate erzielt hat.
Schlussfolgerungen
Vom Revisionismus des 19. Jahrhunderts bis zum Dritten Weg dieser Tage hat die Sozialdemokratie eine wechselvolle Geschichte durchgemacht. Obwohl ihre Strategien, soziale Basis und Zielsetzungen in dieser Zeit erhebliche Wandlungen erlebt haben, gibt es doch auch eine Reihe wichtiger, aber oftmals übersehener, Kontinuitäten. Im späten 19.Jahrhundert verteidigte der aufkommende Revisionismus die Möglichkeit politischer Intervention gegenüber einer ökonomistischen Spielart des Marxismus. Ein Jahrhundert später waren keynesianische und Dritte Weg-Sozialdemokraten, die in allen anderen Fragen zerstritten waren, zumindest in ihrer Ablehnung des neoliberalen Ökonomismus einig, der jenen der Zweiten Internationale noch in den Schatten stellte.
Beide Strömungen der Sozialdemokratie hielten an der Möglichkeit politischer Intervention als Alternative zu den angeblich ehernen Gesetzen der Geschichte fest. Allerdings unterliegt diesem Insistieren auf Intervention seinerseits ein uneingestandener Ökonomismus, den die vorangehende Analyse am Beispiel des ESM sowie der Ideengeschichte der Sozialdemokratie aufgezeigt hat. Dieser Ökonomismus betrachtet wirtschaftliches Wachstum als einen externen Faktor. Bei starkem Wachstum werden staatliche Interventionen als Mittel der Konfliktverarbeitung benutzt; geringes Wachstum wird dagegen als ökonomische Grenze sozialstaatlicher Umverteilung akzeptiert. Das Auseinanderfallen von programmatischen Ansprüchen an politische Intervention und soziale Gerechtigkeit einerseits und der Hinnahme ökonomischer Sachzwänge andererseits führt immer wieder zu Legitimationskrisen. Mit ihrem Versprechen, die Marktkräfte politischer Regulierung zu unterwerfen, können Sozialdemokraten immer wieder Anhänger gewinnen und mobilisieren. Allerdings verlieren sie diese jedes Mal, sobald diese Versprechen nicht gegen die Marktkräfte bzw. die sich dahinter verbergende Macht des Kapitals durchgesetzt werden. So war es auch im Falle des New Economy-Booms. Sobald dieser 2001 in einer Krise endete, nahm die Sozialdemokratie verringertes Wachstum als Einschränkung des Verteilungsspielraums nationaler Sozialstaaten bzw. des ESM hin. Die Folge waren Wahlniederlagen und drastische Mitgliederverluste.
Noch schwieriger wurde die Situation für die Sozialdemokratie, weil die EU-Osterweiterung die mit den Beziehungen zwischen Zentren und Peripherien verbundenen Ungleichheiten in die EU bzw. das ESM hineintrugen. Dadurch wurde im Westen die Hoffnung zerstört, das ESM könne einen Wirtschafts- und Sozialraum entwickeln, der politisch gegenüber der Weltmarktkonkurrenz geschützt sei. Gleichzeitig stellte sich im Osten schnell heraus, dass das mit dem EU-Beitritt verbundene Wirtschaftswachstum lediglich einer kleinen Schicht Neureicher zu Gute kam, aber nichts zur Verbesserung der Lebenssituation der Bevölkerungsmehrheit beitrug. Da sich die Sozialdemokratie stets auf die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb einzelner Nationalstaaten konzentriert und die Ungleichheiten zwischen Zentren und Peripherien vernachlässigt hatte, verfügte sie über keinerlei politische Konzepte zur Überwindung der ökonomischen und sozialen Spaltung Europas, die den politischen Ost-West-Konflikt in den frühen neunziger Jahren abgelöst hatte. Schnell stellte sich heraus, dass die europäische Integration einer Zunahme von Handels- und Kapitalströmen den Weg bereitete, während dem ESM die notwendigen Ressourcen einer erfolgreichen sozialen und regionalen Umverteilung vorenthalten wurden.
Benutzte Literatur:
ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund): Amerikareise deutscher Gewerkschaftsführer, Berlin 1926
Allen, Christopher S.: Social Democracy, Globalization and Governance – Why is there no European Left Program in the EU? Paper Presented at the Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, 3. April 2000
Amendola, Adalgiso u.a.: Regional Disparities in Europe. Università degli Studi di Salerno. Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica, Discussion Paper. No. 78, 2004
van Apeldoorn, Bastian: “Transnational Class Agency and European Governance: The Case of the European Roundtable of Industrialists”, in: New Political Economy, Vol. 5, No. 2/2000, S.157–182
van Apeldoorn, Bastian: Transnational Capitalism and the Struggle over Europe, London/New York 2002
Aust, Andreas: „‚Dritter Weg‘ oder ‚Eurokeynesianismus‘ – Zur Entwicklung der Europäischen Beschäftigungspolitik seit dem Amsterdamer Vertrag“, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 29.Jg., Heft 3/2000, S.269–283
Balanyá, Belén u.a.: Europe Inc. – Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power, London/Sterling 2000
Bauer, Otto: Rationalisierung – Fehlrationalisierung, Wien 1931
Becker, Joachim: „Transformation, soziale Unsicherheit und der Aufstieg der Nationalkonservativen in Zentralosteuropa“, in: Prokla, 36.Jg., Heft 3/2006, S.397–418
Berman, Sheri: The Primacy of Politics – Social Democracy and the Making of Europe’s Twentieth Century, Cambridge 2006
Bernstein, Eduard: Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (1899), Reinbek bei Hamburg 1969
Bernstein, Eduard: „Der Sozialismus einst und jetzt“ (1922), in Iring Fetscher: Der Marxismus, München/Zürich 1983, S.586f.
Bieler, Andreas: The Struggle for a Social Europe – Trade Unions and EMU in Times of Global Restructuring, Manchester/New York 2006
Birnbaum, Norman: After Progress – American Social Reform and European Socialism in the Twentieth Century, Oxford 2001 (dt. Ausgabe: Nach dem Fortschritt. Vorletzte Anmerkungen zum Sozialismus, Stuttgart 2003)
Blackburn, Robin: “Capital and Social Europe”, in: New Left Review, II/34, July/August 2005, 87–112
Bohle, Dorothee/Greskovits, Béla: Capital, Labor, and the Prospects of the European Social Model in the East, Central and Eastern Europe Working Paper 58, Harvard University 2004
Cerami, Alfio: Social Policy in Central and Eastern Europe – The Emergence of a New European Model of Solidarity?, Paper presented at the Third Annual ESPAnet Conference 22–24.September 2005, University of Fribourg
Coates, David: Models of Capitalism – Growth and Stagnation in the Modern Era, Cambridge/Malden 2000
Crouch, Colin: “The Parabola of Working Class Politics”, in A.Gamble/T.Wright (Hrsg.): The New Social Democracy, Oxford/Malden 1999, S.69–83
Diamantopoulou, Anna: The European Social Model – Myth or Reality? Address at the fringe meeting organized by the European Commission’s Representation in the UK, Bournemouth (UK), 29. September 2003
Dimitroff, Georgi: „Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus“ (1935), in: Idem. Gegen Faschismus und Krieg, Leipzig 1982, S.49–136.
Dunn, Walter Scott: The Soviet Economy and the Red Army, 1930–1945, New York u.a. 1995
Ebbinghaus, Eberhard/Manow, Philip: Comparing Welfare Capitalism – Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the US, London/New York 2001
Eley, Geoff: Forging Democracy – The History of the Left in Europe 1850–2000, Oxford 2002
Esping-Anderson, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990
Erne, Roland: European Unions – Labor’s Quest for a Transnational Democracy, Ithaca/London 2008
ECB (European Central Bank): Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, 2003: http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
EESC (European Economic and Social Committee): The EESC – A Bridge between Europe and Organized Civil Society, Brüssel 2007
ETUC (European Trade Union Congress) (2005a): What is the “European Social Model” or “Social Europe”?, 2005, http://www.etuc.org/a/111
ETUC (2005b): The Case for Europe – Shaping a Strong Social Europe, Brüssel 2005
EU (European Union) (1997): Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact – Amsterdam, 17.Juni 1997: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0802(01):EN:HTML
EU (2000): Presidency Conclusions – Lisbon European Council – 23 and 24 March 2000: http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
EU (2005): Social Charter: http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10107.htm
EU (2007): A New Title on Employment in the Amsterdam Treaty: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/develop_en.htm#Amsterdam
EuroMemorandum Group (2001): Economic Policy Against Recession and Polarization in Europe: http://www.memo-europe.uni-bremen.de/downloads/Euromemo_Final.PDF
EuroMemorandum Group (2007): Full Employment with Good Work, Strong Public Services and International Cooperation: http://www.memo-europe.uni-bremen.de/downloads/EM07_final_version_19_Nov.pdf
European Commission: 20 Years of Social Dialogue – Social Dialogue Summit, 29.September 2005, Brüssel 2006
Fajertag, Guiseppe/Pochet, Philipe (Hrsg.): Social Pacts in Europe – New Dynamics, Brüssel 2000
Galbraith, John K.: American Capitalism: The Concept of Countervailing Power, Boston 1952
Greskovits, Béla: “Economic Woes and Political Disaffection”, in: Journal of Democracy, Vol. 8., No. 4/2007, S.40–46
Gustafsson, Bo: Marxismus und Revisionismus, Frankfurt/M. 1972
Habermas, Jürgen: Technik und Wissenschaft als “Ideologie”, Frankfurt/Main 1968
Habermas, Jürgen: Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien. in ders.: Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt/M. 1985, S.141–163
Hall, Peter A: The Political Power of Economic Ideas – Keynesianism Across Nations, Princeton 1989
Hall, Peter A./Soskice, David W.: Varieties of Capitalism, Oxford 2001
Hermann, Christoph: “Neoliberalism in the European Union”, in: Studies in Political Economy, Spring 1997, 2007, S.61–89
Hermann, Christoph: The European Social Models – Contours of the Discussion, Unpubl. MS. 2008
Hermann, Christoph/Hofbauer, Ines: “The European Social Model – Between Competitive Modernisation and Neoliberal Resistance”, in: Capital & Class, Heft 93, Autumn 2007, S.125–139
Hilferding, Rudolf: „Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik“ (1927), in W.Luthardt (Hrsg.): Sozialdemokratische Arbeiterbewegung und Weimarer Republik, Frankfurt/M. 1978, S.369–393
Hirst, P./Thompson, G.: Globalization in Question, Cambridge u.a. 1999
Iversen, Torben u.a. (Hrsg.): Unions, Employers and Central Banks – Macroeconomic Coordination and Institutional Changes in Social Market Economies, Cambridge 2000
Koll, Willi: “Macroeconomic Dialogue – Developments and Intentions“, in E.Hein u.a. (Hrsg.): Macroeconomic Policy Coordination in Europe and the Role of the Trade Unions, Brüssel 2005, S.175–212
Laitko, Hubert: “Wissenschaftlich-technische Revolution – Akzente des Konzepts in Wissenschaft und Ideologie der DDR“, in: Utopie Kreativ, Heft 11/1996, S.33–50
Lash, Scott/Urry, John: The End of Organized Capitalism, Madison 1987
Lenin, W.I.: „Das Taylorsystem – Die Versklavung des Menschen durch die Maschine“ (1914), in: Lenin-Werke, Band 20, Berlin/Ost 1971, S.145–147
Lenin, W.I.: Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht. (1918), in: Lenin-Werke, Band 27, Berlin/Ost 1971, S.225–268
Mandelbaum, Kurt: Sozialdemokratie und Imperialismus, Berlin 1974
Moschonas, Gerassimos: In the Name of Social Democracy – The Great Transformation, 1945 to the Present, London/New York 2002
Mückenberger, Ulrich u.a. (Hrsg.): Die Modernisierung der Gewerkschaften in Europa, Münster 1996
Neubert, Harald: „Sozialisten und Kommunisten in Europa“, in: Z – Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Heft 47, September 2001, S.34–48
Notermans, Ton: Money, Markets, and the State – Social Democratic Economic Policies since 1918, Cambridge 2000
Pontusson, Jonas: Inequality and Prosperity – Social Europe vs. Liberal America, Ithaca/London 2005
Policy Network: Where Now for European Social Democracy?, London 2004
Putnam, Robert D.: “Diplomacy and Domestic Policies – The Logic of Two-Level Games”, in: International Organization, Vol. 42, No. 3/1988, S.427–460
Rasmussen, Poul Nyrup/Delors, Jacques: The New Social Europe, Brüssel 2007
Risse, Thomas: An Emerging European Public Sphere? Theoretical Clarifications and Empirical Indicators, Paper presented to the Annual Meeting of the European Union Studies Association (EUSA), Nashville, 27.-30.März2003
Reich, Robert B.: The Work of Nations New York 1991 (dt. Ausgabe: Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen Ökonomie, Frankfurt/Berlin 1993)
Sassoon, Donald: One Hundred Years of Socialism – The West European Left in the Twentieth Century, New York 1996
Sassoon, Donald (Hrsg.): Looking Left – Socialism in Europe After the Cold War, New York 1997
Scharpf, Fritz W.: Crisis and Choice in European Social Democracy, Ithaca/London 1991
Scharpf, Fritz W.: European Governance: Common Concerns vs. The Challenge of Diversity, Köln: MPIfG Working Paper 1/6.September 2001
Scharpf, Fritz W.: “The European Social Model – Coping with the Challenges of Diversity”, in: Journal of Common Market Studies, Vol. 40, Heft 4/2002, S.645–670
Schmidt, Ingo (Hrsg.): Spielarten des Neoliberalismus, Hamburg 2008
Schmidt, Vivien A.: The Futures of European Capitalism, Oxford 2002
Streeck, Wolfgang/Yamamura, Kozo (Hrsg.): The Origins of Nonliberal Capitalism – Germany and Japan in Comparison, Ithaca/London 2005
Stützel, Wieland (Hrsg.): Streik im Strukturwandel – Die europäischen Gewerkschaften auf der Suche nach neuen Wegen, Münster 1994
Suppiot, Alain: „Possible Europes“, in: New Left Review, II/57, May-June 2009, S.57–66
Wehr, Andreas: „Die Linke im Europäischen Parlament“, in: Z – Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Heft 47, September 2001,S.34–48
Wulf, Hans Albert: Maschinenstürmer sind wir keine – Technischer Fortschritt und sozialdemokratische Arbeiterbewegung, Frankfurt/New York 1987
Das englische Original dieses Beitrages erschien in den Studies in Political Economy, Vol. 84, Fall 2009, 7–28.